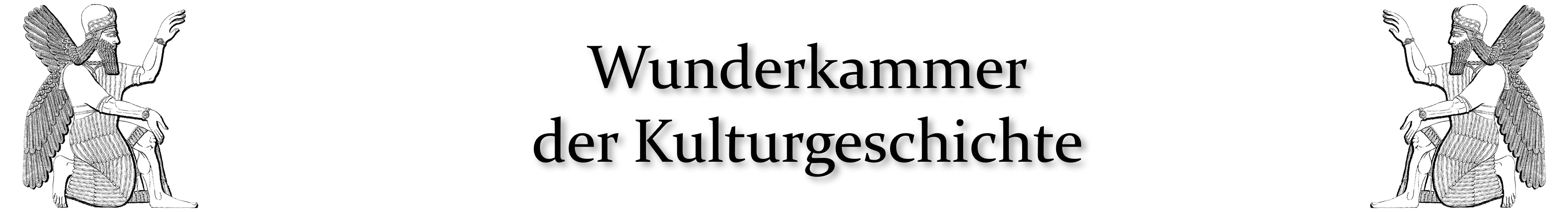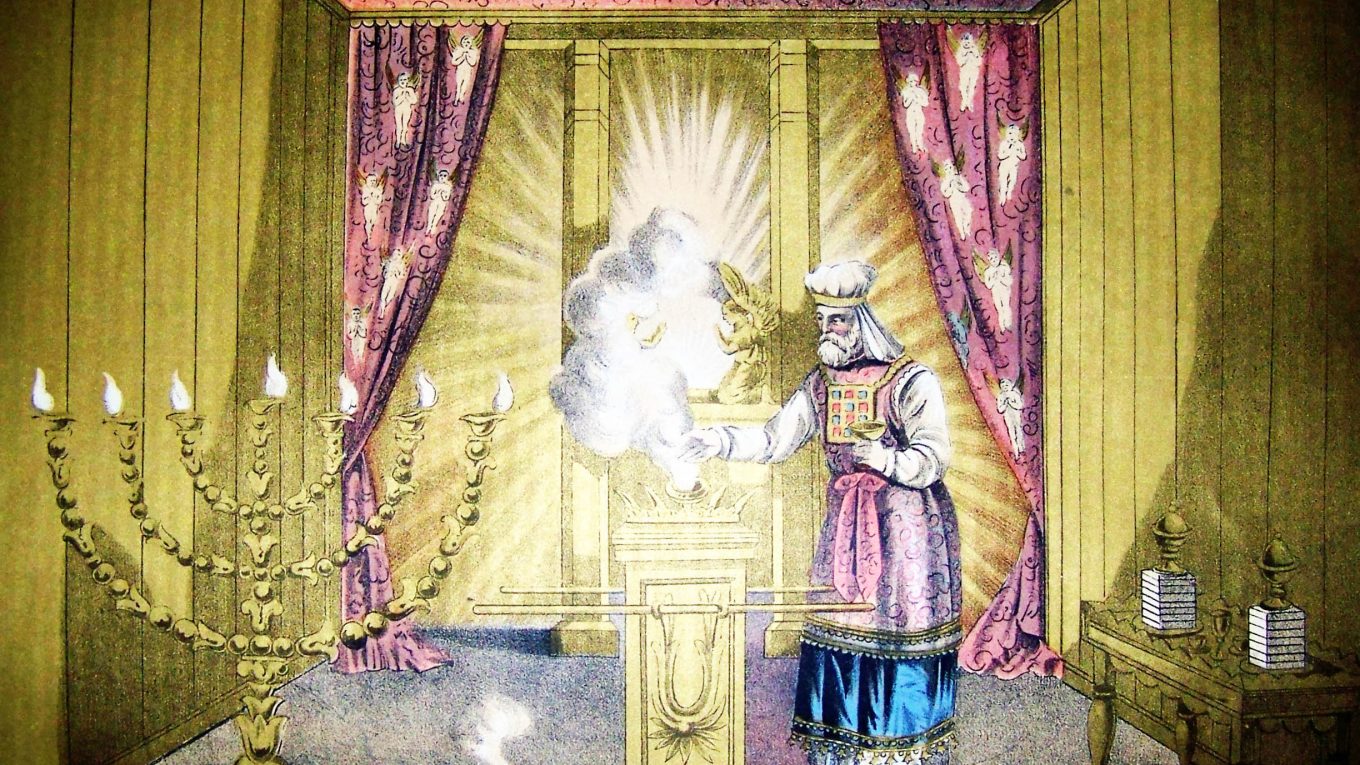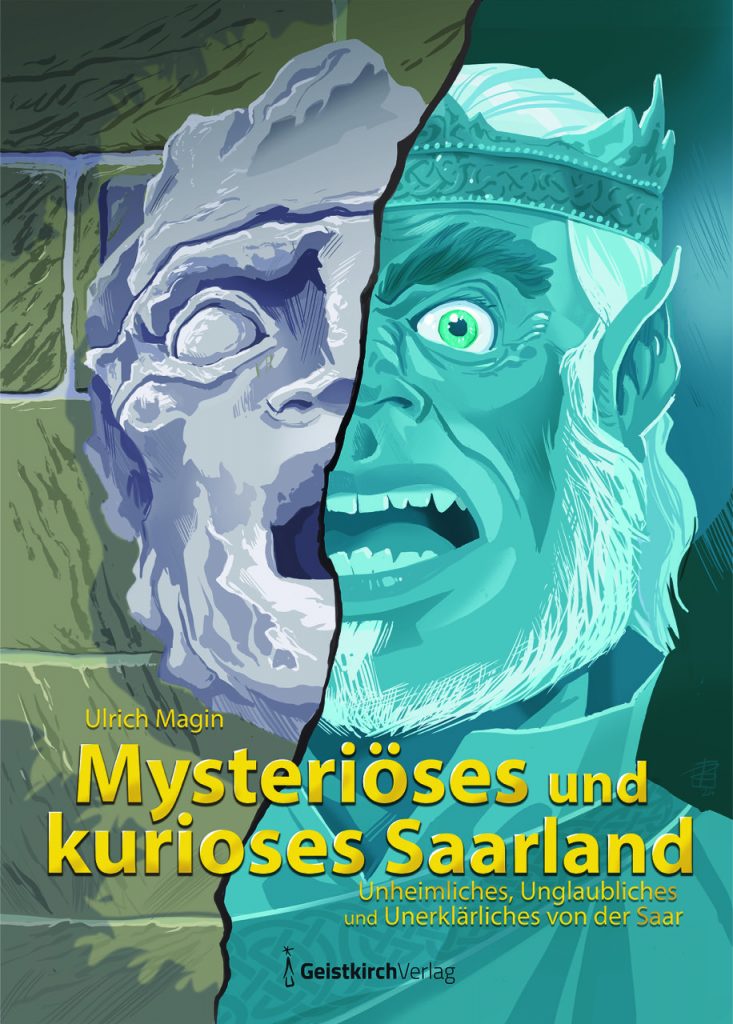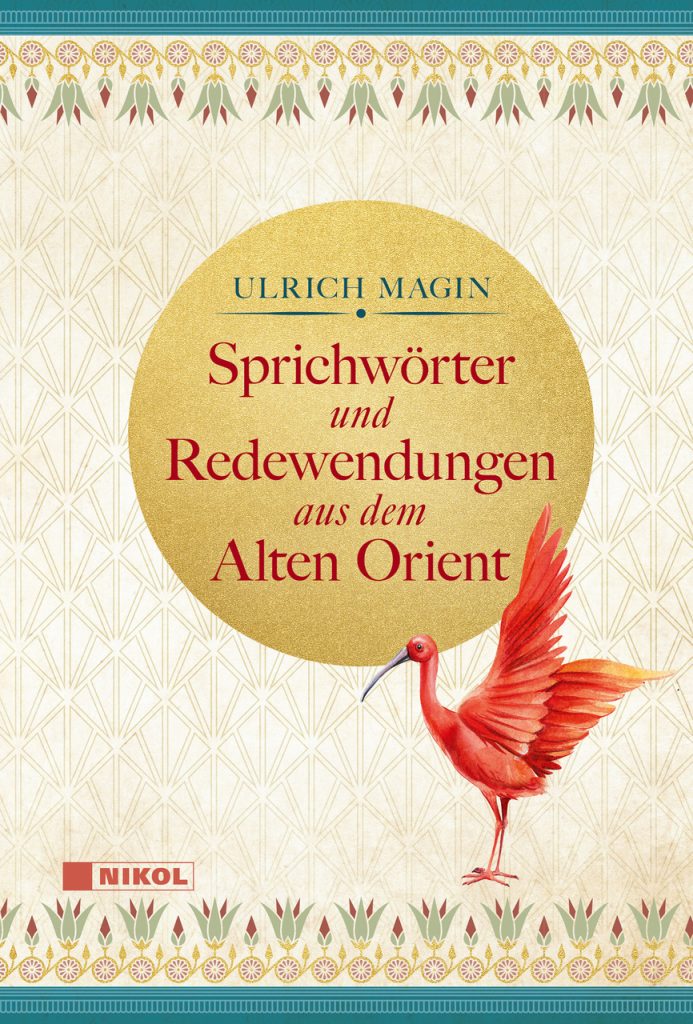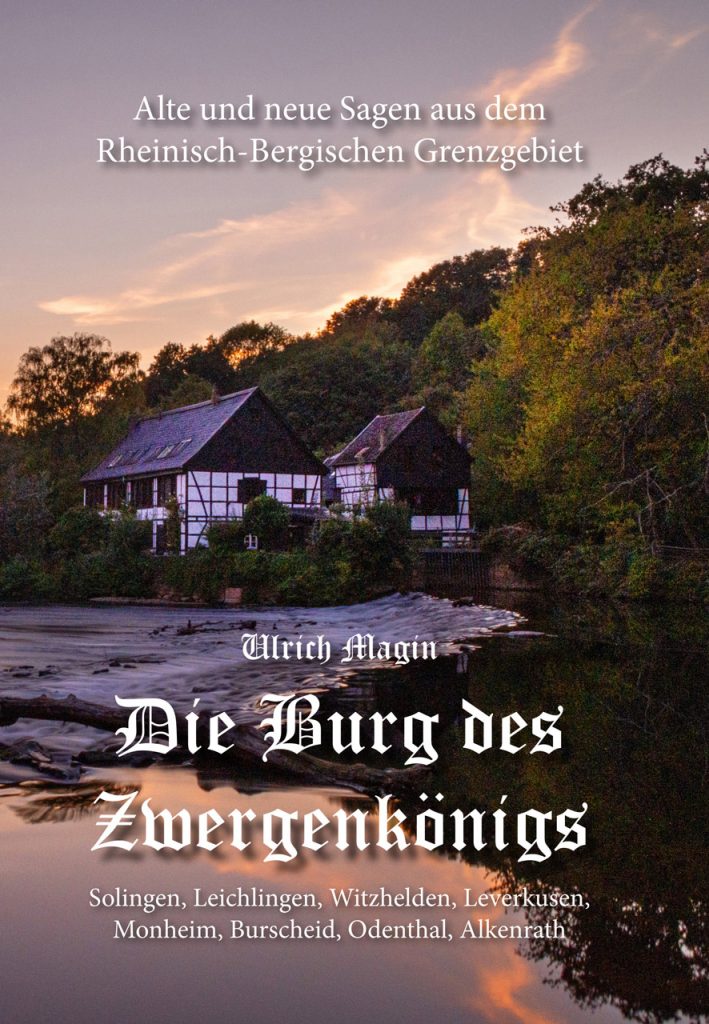Die Schechina: Ein religiöser Begriff und seine Missverständnisse
Abb. 1: Hohepriester Israels vor dem Allerheiligsten. Illustration aus der Holman-Bibel, 1890 (Wikimedia Commons).
Es gibt, so sagt Peter Fiebag[1] in einem Beitrag über die angebliche Manna-Maschine, eine außerirdische Brotbackmaschine, die Aliens dem Moses gaben, „den seltsamen jüdischen Begriff der ‚Schechina‘“. Seltsam ist der Begriff natürlich nur für Außenstehende, die sich nicht die Mühe machen, sich über das Judentum zu informieren. Ignorieren wir die Arroganz, die aus der Verächtlichmachung eines zentralen Begriffs der jüdischen Mystik spricht, und sehen uns die Fakten an, die Fiebag nicht kennen will.
In deutschen Übersetzungen des Talmud wird die Schechina mit „Einwohnung“ übertragen, mit der Gegenwart Gottes in seiner materiellen Schöpfung also, und sie taucht nicht erst bei Moses oder beim Exodus auf, vielmehr begleitet sie bereits Abraham und Isaak.[2] Später verließ die Schechina nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer ihren Platz auf der Bundeslade und kehrte zum Himmel zurück.[3] Von dort strahlt sie in die Welt aus, mit ihr ist Gott im Alltag präsent.
Mehr weiß die erst nach dem Talmud verfasste Kabbala, auf die sich Johannes und Peter Fiebag berufen, über die Schechina. Das erste Kabbala-Buch, das Buch Bahir, entstand um 1176 in Südfrankreich.[4] Es kommt „scheinbar aus dem Nichts“, denn die angeblich antiken Wurzeln, auf die es Bezug nimmt, sind wissenschaftlich nicht nachweisbar.[5] Das Buch Bahir entwirft erstmals die kabbalistische Vorstellung von den zehn Sephirot (auch Sefirot geschrieben) Gottes, seinen „zehn Wesensbestimmungen“. Man könnte sagen, dass die Kabbala versucht, mit diesen zehn Charakteristika Gottes Wesen zu beschreiben. Die Technik, mit der die Kabbalisten zu dieser Definition Gottes kamen, war die der mystischen Bibelauslegung.
Eine der Sephira enthält den Begriff Schechina. Das ist ein altes hebräisches Wort. Im Alten und im Neuen Testament bedeutet Schechina „die Herrlichkeit Gottes“. In der Kabbala wird Schechina dann zur Bezeichnung „der weiblichen Seite Gottes“: „das weibliche Gotteselement […], d.i. d(ie) der Welt ‚einwohnende‘ Göttlichkeit“.[6]
Die Schechina ist die „Gelenkstelle zwischen Welt und Gott, sie wird innergöttlich als ‚Gattin‘ und für die Welt als ‚Tochter‘ bestimmt“.[7] In anderen Worten: Die Schechina ist konkret der Wesenszug Gottes, der sich liebevoll, wie eine körperliche Frau gar, der Welt zuwendet; durch diese Zuwendung offenbart sich Gott in seiner Schöpfung. Diese Wendung von abstrakten Vorstellungen einer herrlichen Immanenz Gottes in der Welt zu einer quasi-weltlichen Gegenwart Gottes ist das eigentlich revolutionäre an der Kabbala und – wie der Judaist Peter Schäfer jüngst bei einem Vortrag vor der Deutschen Forschungsgemeinschaft gezeigt hat – auf den Kontakt der Juden mit der christlichen Marienverehrung zurückzuführen.[8]
Die ersten Texte des Buchs Sohar, das den britische Autoren Dale und Sassoon und nach ihnen den Fiebags als Quelle für die technologische Interpretation der Schechina dient, sind erst 100 Jahre nach dem Bahir entstanden, nämlich um 1275–1293 in Kastillien.[9] Der Autor ist Mose ben Schemtow de Leon (1250–1305), der angibt, sein Werk stamme von dem Talmudisten Schim’on ben Jochai (2. Jahrh. n. Chr.), eine Angabe, die schon aufgrund der sich „aus dem Textinhalt […] ergebende[n] Unmöglichkeit“ nicht zutreffen kann.[10] Durchaus möglich ist, dass der Sohar auf Überlieferungen über ben Jochai zurückgeht, doch ist sein Verfasser unstrittig Mose de Leon.
Im Sohar wird „der jenseitigen, unerkennbaren Gottheit, dem unendlichen Urgrund […] die Emanation und Ausfaltung Gottes in die zehn göttlichen Schöpfungs- und Seinskräfte, die zehn Sefirot, zugeordnet. […] Die unterste Sefira, Malchut, ‚das Reich‘, birgt die Schechina, durch die der Mensch religiös bzw. kontemplativ mit der Gottheit in Verbindung treten kann.“[11] Dabei bedeutet Schechina „die innerweltliche Allgegenwart der Herrlichkeit Gottes. Aus biblischen Textstellen herauslesbar und im Talmud erwähnt, wird die Schechina in der Kabbala zur zentralen Größe: Sie ist die aufs Innerweltliche ‚eingeschränkte‘ weibliche Seite der Gottheit; ihr Schicksal ist mit dem der Welt und insbesondere dem der Kinder Israel verknüpft. […] Die Erlösung der Schechina aus ihrem irdischen Exil ist untrennbar verschränkt mit dem Erlösungsweg des Menschen – der Heilung seiner selbst.“[12] Oder, wie es der chassidische Gelehrte Raphael von Berschad sagt: „Verharren die Kinder Israel liebevoll in brüderlichem Einssein, dann schwebt die Schechina über ihnen in aller segensreichen Heiligkeit.“[13]
Der Sohar selbst gibt u.a. folgende Definition der Schechina, in einen Abschnitt, im dem die Himmelsleiter, die Jakob erscheint, mit dem Gebet gleichsetzt wird:
„‚Auf der Erde‘ heißt es [in der Bibelstelle 1. Moses 28: 12], weil es sich um das Gebet von Menschen handelt; der Boden aber, von dem es aufsteigt, ist die Schechina. ‚Und ihr Haupt reicht zum Himmel‘ – das ist der Allerheilige selbst, denn Er wird auch Himmel genannt. […] In der Zeit, da der Allerheilige sich kundtut, steigt die Schechina mit dem Gebete auf. Darum heißt es auch gleich: ‚Und siehe, göttliche Boten steigen durch ihn auf und nieder.‘ Das Wort ‚durch ihn‘ bezieht sich auf den Menschen. Und sie alle öffnen die Flügel der Schechina entgegen durch die Macht des Gebetes. […] Die da aufsteigen, folgen der Schechina, herabsteigt aber der Allerheilige selber, der Schechina entgegen, um sich mit ihr zu vereinigen – durch das Gebet des Menschen. Die Schechina erhält ihre belebende Kraft aus der Geboteerfüllung im göttlichen Namen.“[14]
Die Schechina ist also kein Begriff, der in dem Sohar nur in der Beschreibung einer Kraft auftritt, die das Manna erzeugt: Schechina ist ein zentraler Begriff der Kabbala. Der ganze Sohar ist im Grunde der Versuch, die Schechina zu definieren und zu erklären. Der Sohar ist ein religiöses Buch, eine philosophische Abhandlung; prä-astronautisch deutbare Absätze sind eben gerade nicht darin, wie sich jeder gerne aufgrund der exzellenten Ausgabe von Müller überzeugen kann. Die Kabbala ist auch keine geheime, jahrtausendealte Tradition, sondern eine Sammlung von Bibelversauslegungen, vergleichbar mit dem Talmud.
„Schechina“ kann schwerlich ein Synonym für die Manna-Maschine sein, wenn die „Schechina“ längst vor Moses bei den Urvätern war. Es geht in den Texten, die die Schechina beschreiben, auch nicht um das Manna, sondern um die göttliche Gegenwart in der Welt. Diese manifestiert sich natürlich auch im Manna, und daher ist das Manna ein Produkt der Schechina. Doch ebenso ein Produkt der Schechina ist die Liebe zwischen Mann und Frau, und es kann definitiv festgestellt werden, dass dieses Phänomen auch unabhängig von einer aus dem Kosmos stammenden Brotbackmaschine vorzukommen pflegt.
Die stark vom Sohar beeinflusste jüdische Neuerungsbewegung der Chassidim hat übrigens die Schechina zum zentralen Begriff ihres Gottesverständnisses gemacht. So wie Gott sich mit der Schechina der Welt hingibt, so soll sich der gläubige Jude naiv und ohne Intellekt ganz Gott hingeben. Martin Buber, der große jüdische Philosoph, schreibt dazu:
„Die talmudische, von der Kabbala ausgebaute Lehre von der Schechina, der ‚einwohnenden Gegenwart‘ Gottes in der Welt, bekam [im Chassidismus] einen neuen, intimen Gehalt: wenn du die unverkürzte Kraft deiner Leidenschaft auf Gottes Weltschicksal richtest, wenn du das, was du in diesem Augenblick zu tun hast, was es auch sei, zugleich mit deinen ganzen Kraft und mit solcher heiligen Intention tust, einst du Gott und Schechina, Ewigkeit und Zeit.“[15]
Diese etwas abstrakten Worte verdeutlicht eines der chassidischen Gleichnisse:
„Rabbi Ascher von Stolyn erzählte: ‚Mein Lehrer, Rabbi Schlomo, pflegte zu sagen: ‚Ich muß vorbereiten, was ich in der Hölle zu tun habe.‘ Denn er war gewiß, daß ihm kein besseres Los beschieden sei. Als nun nach dem Abscheiden seine Seele aufstieg und die Dienstengel ihn freudig empfingen, um ihn zum höchsten Paradiese zu geleiten, weigerte er sich, mit ihnen zu gehen. ‚Man narrt mich‘, rief er, ‚das kann die Welt der Wahrheit nicht sein.‘ Bis die Schechina selbst sprach: ‚Komm, mein Sohn, gnadenhalber will ich dich aus meinem Schatz beschenken.‘ Da gab er sich zufrieden.“[16]
Natürlich stand in seiner Todesstunde „das Buch Sohar […] aufgeschlagen“ vor ihm.[17]
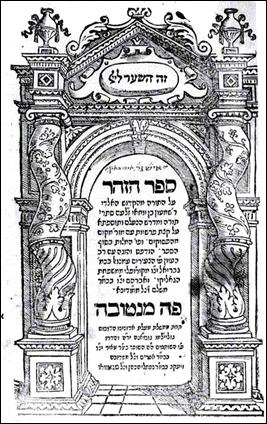
Stolz prangt in Fiebags Entdeckung des Grals das Wort Schechina über zwei Seiten[18] als Name der Manna-Maschine. Es dürfte deutlich geworden sein, dass eine solche Identifikation an den Haaren herbeigezogener Unsinn ist. Man könnte diese Feststellung auch eleganter treffen, aber dann wäre sie bereits verlogen. Von den theologischen Spitzfindigkeiten des Sohar wollen die Brüder Fiebag in der Entdeckung des Grals[19] nichts wissen: „In der Tat glauben wir Hinweise dafür zu haben, daß Schechina nichts anderes ist als ein weiteres Synonym der Manna-Maschine.“ Was ist dann der Heilige Geist – eine Kaffeemaschine? Schließlich erquickt er uns und weckt uns auf!
Wie bereits gesagt, ist der Sohar kein antiker Text, sondern ein typischer Midrasch, d.h. eine Auslegung der fünf Bücher Mose durch die Rabbiner. So verwundert es nicht, dass alle im Sohar vorkommenden Begriffe aus der Thora stammen. Der „Uralte der Tage“ ist nicht, wie die Fiebags behaupten, ein Codewort für die Manna-Maschine, sondern ist ein Gottesname aus dem Buch Daniel (7: 9), die Schechina selbst ist die Gegenwart der weiblichen Seite Gottes im untersten Sefira, Malchut. Dass diese Interpretation, und nicht die der Fiebags zutrifft, zeigt sich im Sohar deutlich an den vielen Stellen, an denen die Schechina ausdrücklich als Charakteristikum Gottes beschrieben wird. Zudem taucht sie nicht erst bei Moses oder beim Exodus auf, vielmehr hat sie bereits Abraham und Isaak begleitet:
„Warum heißt es (bei 1 Moses 13: 2): ‚seinen Wanderzügen‘ und nicht ‚seinem (Abrahams) Wanderzuge nach?‘ Weil ihrer zwei sind, der Abrahams und der der Schechina. Es soll nämlich jeder Mensch danach streben, daß Männliches und Weibliches stets zusammen sich finde, damit die Verbindung der Treue erstarke und die Schechina für ewig sich nicht entferne. […] Wer einen Pfad geht, wo Männliches und Weibliches sich nicht zusammenfinden, von dem sondert sich die Schechina. […] So heißt es denn: ‚Und du sollst wissen, daß Friede dein Zelt sei‘ – daß nämlich die Schechina zu dir komme und in deinem Hause Wohnung nehme …‘ Nämlich der Wonne der Pflicht genügen im Anblick der Schechina. […] In der Zeit, wenn der Mann in seinem Hause weilt, ist die Wurzel des Hauses seine Gattin, denn um der Gattin willen weicht die Schechina nicht vom Hause. Wie wir gelernt haben: ‚Es brachte sie Isaak ins Zelt Sarahs seiner Mutter‘ (1. Moses 24,67). Damals entzündete sich von selbst ein Licht. Es war nämlich die Schechina ins Haus gekommen.“[20]
Tatsächlich, so der Sohar, kam die Schechina mit der Erschaffung der Welt in die Welt. Zu dem Vers Genesis 1: 1 erklärt der Sohar[21]: „Den Himmel – das ist die obere, die Erde die untere Schechina, in der Verbindung des Männlichen mit dem Weiblichen zur Einheit kommend.“ Wahrlich eine präzise Darstellung einer Algenproduktions- und Brotbackmaschine aus der Zeit des Exodus!
Auch im späteren Judentum, etwa bei den Chassiden, drückt die Schechina die Liebe Gottes zur und in der Welt aus.[22] Weil die Schechina in der jüdischen Theologie die Gegenwart Gottes in der materiellen Welt bedeutet, nennen die Chassiden den Thronwagen Gottes, den der Prophet Ezechiel in seinen Visionen erblickte, auch den Wagen der Schechina. Folgt man also der prä-astronautischen Darstellung, ist das „Raumschiff des Hesekiel“ identisch mit der Manna-Maschine!
Es zeigt sich schon, dass die Sohar-Deutung der Brüder Fiebag recht eigenwillig ist, der Gedanke drängt sich ohnehin auf, sie hätten das Buch Sohar nicht gelesen, sondern nur nach Dale und Sassoon zitiert. So kommt es zu weiteren Falschdeutungen wie der, der im Sohar genannte „Tau“ sei das Manna der Manna-Maschine gewesen.[23] Tatsächlich ist auch „Tau“ ein biblischer Begriff, nämlich aus Micha (5: 7): „Und es wird sein der Rest Jakobs unter den Nationen, im Innern der Völkermenge, wie Tau vom Allerhöchsten, wie Frühtropfen auf dem Gewächs.“ Das Tau ist also, wie die Schechina, die Gegenwart Gottes in der Welt. Als solches ist natürlich auch das Manna „Tau“ Gottes.
Mehr noch: Die frühen Christen haben den Begriff übernommen. Paulus erwähnt die Schechina im Römerbrief 9: 4.[24]
Neben Altem und Neuem Testament, Talmud und Kabbala erwähnt auch der Koran die Schechina (arab.: Sakinat), und zwar an sechs Stellen in drei Suren. Jedes Mal bedeutet das Wort den Frieden Gottes in der Welt, nie aber kann man einen Verweis auf eine wie auch immer geartete Maschine daraus lesen:
- Sure 2, Vers 249: „Das Zeichen seines Königtums ist, dass die Lade zu euch kommt, in der Gottesruhe von eurem Herrn (Sakinat) ist.“
- Sure 9, Vers 26: „Dann hat Allah Seine Gottesruhe (Sakinat) auf seinen Gesandten (Muhammad) herabgesandt und auf die Gläubigen.“
- Sure 9, Vers 40: „‚Sei nicht traurig, Allah ist ja mit uns!‘, da sandte Allah seine Gottesruhe (Sakinat) auf ihn (Muhammad).“
- Sure 48, Vers 4: „Und er ist es, der die Gottesruhe (Sakinat) in die Herzen der Gläubigen hinabsandte.“
- Sure 48, Vers 18: „Er (Allah) hat die Gottesruhe (Sakinat) herabgesandt auf sie.“
- Sure 48, Vers 26: „da sandte Allah seine Gottesruhe (Sakinat) herab auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen.“
Arabische Gelehrte haben Kommentare zu fast jedem Wort des Korans geschrieben. Elpherar sagt, das Wort Sakinat in Sure 9, 26 bedeutete „Sicherheit und Ruhe“ und in seinem Kommentar zu Sure 48, 4 schreibt er: „Ben Abbas sagt, das Wort Sakinat bedeutet im Koran immer Ruhe außer in der zweiten Sure.“[25] Manche deutschen Koranübersetzungen schreiben statt Gottesruhe auch „Frieden“ oder „Ruhe“.
Zum prä-astronautischen Konstrukt der Manna-Maschine siehe auch:
Ulrich Magin (Mysteria3000): Brezeln aus dem Weltraum – Was die alten Schriften sagen
Ulrich Magin (Mysteria3000): Brezeln aus dem Weltraum – Von Templern und Gralsburgen
Ulrich Magin (Mysteria3000): Manna-Maschine und Gral – Neue Entdeckungen
Frank Dörnenburg (Pyramidengeheimnisse): Manna in der Wüste / Bibel und Technik / Produktionsraten/ Ausbeute der Maschine / Sassoons Kommentar
Ulrich Magin lebt nahe Bonn und ist Autor zahlreicher Bücher, darunter Megalithen in Deutschland sowie Unter der Erde: Unterirdische Anlagen in Deutschland von der Steinzeit bis heute.
[1] Fiebag, P. 1995: Beschreibung eines außerirdischen Reliktes in der mittelhochdeutschen Parzival-Sage, in: P. / J. Fiebag (Hg.), Aus den Tiefen des Alls. Ullstein, Berlin, 319–348, 335.
[2] Mayer, R. (Hg.) 1999: Der Talmud. Orbis, München, 121, 250, 288, 289, 298, 372, 396, 423, 448, 515, 529, 614, 618.
[3] Im Traktat Rosch haSchanah 31a, nach Betz, O. / Riesner, R. 1999: Verschwörung um Qumran. Moeweig, Rastatt, 100.
[4] Roberts, M. 1995: Das Neue Lexikon der Esoterik. Goldmann, München, 110.
[5] Zander, H. 1998: Gattin Gottes. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. April 1998.
[6] Müller, E. (Hg.) 1998: Der Sohar. Diederichs, München, 19.
[7] Zander 1998.
[8] Zander 1998.
[9] Roberts 1995, 343.
[10] Müller 1998, 15.
[11] Kobbe, P. 1994: Chassidische Weisheit. Knaur, München, 241.
[12] Kobbe 1994, 245.
[13] Nach Kobbe 1994, 128.
[14] Müller 1998, 264.
[15] Buber, M. o. J.: Die Erzählungen der Chassidim. Manesse, o.O., 19.
[16] Buber o. J., 438.
[17] Buber o. J., 437.
[18] Fiebag, P. / J. 1989: Die Entdeckung des Grals. Goldmann, München, 310 f.
[19] Fiebag 1989, 190.
[20] Müller 1998, 142.
[21] Müller 1998, 304. Wer in der Sohar-Edition von Müller alle Stellen zur Schechina sucht, sie wird erwähnt auf den S. 38, 44, 55, 56, 91, 92, 95, 123, 134, 142, 143, 158.
[22] Kobbe 1994, 249.
[23] Fiebag 1989, 103–105.
[24] Luther übersetzt mit „Herrlichkeit“. Zur Schechina im Römerbrief: Howson, J. S. 1896: The Life and Epistles of St. Paul. Longmans, Green & Co., London, 58, 520; Ragaz, L. 1950: Die Bibel – eine Deutung. Band VI: Die Apostel. Diana, Zürich, 149.
[25] Ibn Warraq (Hg.) 1998: The Origins of the Koran. Prometheus, Amherst, 170, 379.