Das Gilgamesch-Epos ist NICHT die älteste Erzählung der Menschheit!
Abb. 1: Gilgamesch und Enkidu töten Ḫumbaba. Altbabylonisches Terrakottarelief, 18.‒17. Jh. v. Chr. (VAM Berlin 07246; Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Vorderasiatisches Museum / Olaf M. Teßmer CC BY-SA 4.0).
Es mag trivial sein, aber es regt mich auf.
Das Gilgamesch-Epos, jenes Langgedicht über die Heldentaten und Leiden des gleichnamigen Königs von Uruk, ist mit Sicherheit das bekannteste Literaturwerk aus dem antiken Mesopotamien. So überrascht es wenig, dass dieses außerhalb der altorientalistischen Forschung häufig genannt und ebenso häufig falsch eingeordnet wird: Die vielleicht häufigste Fehlinformation über das antike Mesopotamien, die mir immer wieder begegnet, ist jene, das Gilgamesch-Epos sei die älteste schriftliche überlieferte Erzählung der Menschheit.
Mit erschreckender Regelmäßigkeit und Selbstverständlichkeit findet sich diese Behauptung in den Titeln und Klappentexten diverser Textausgaben und Nachdichtungen:
- Reclam betitelt seine Ausgabe als „die älteste überlieferte Dichtung der Welt“
- Die Textausgabe vom Anaconda-Verlag (2024) titelt „Eine der ältesten schriftlich fixierten Dichtungen der Welt“ – und im Amazon-Beschreibungstext dann: „Die älteste Dichtung der Welt“
- Textausgabe vom Marix-Verlag (2012): Das Gilgamesch-Epos: Der älteste überlieferte Mythos der Geschichte
- Nacherzählung von Geschichtskosmos (2024):Die Epen von Gilgamesch: Eine epische Reise in die mesopotamische Mythologie – der erste König auf der Suche nach Unsterblichkeit: „Tauchen Sie ein in das Epos von Gilgamesch, eine fesselnde Reise in die älteste bekannte Geschichte der Menschheit …“
- Nachdichtung von Raoul Schrott: „Das älteste Stück Literatur, das wir kennen“
- Nachdichtungen von Wolf Wieland (2016): Gilgamesch: Das älteste Epos der Menschheit und (2020): Gilgamesch-Epos und Gilgameschs Tod: Das älteste Epos der Menschheit
In dieselbe Kerbe schlägt der Jugend-Fantasy-Roman Sikander gegen die Götter – Das Schwert des Schicksals von Sarwat Chadda (2022), der sich vorgeblich mit der Mythologie des Alten Orients beschäftigen will (siehe meine Rezension):
„Wie viele Versionen des Gilgamesch-Epos hatte ich im Laufe der Jahre gelesen? Wahrscheinlich alle, die es gibt. [Offensichtlich nicht; Anm. LI] Es ist die älteste schriftlich überlieferte Geschichte der Welt“.
Und nicht zuletzt ‒ besonders erschreckend – findet sich die These selbst in populärwissenschaftlichen Werken anerkannter (Natur-)Wissenschaftler:
Gisela Graichen / Harald Lesch, Liegt die Antwort in den Sternen? (2022, 265):
„Was war vor Noah und der Sintflut, von der uns die Bibel berichtet und davor die älteste erhaltene Erzählung der jetzigen Menschheit, das Gilgamesch-Epos, das sich wiederum aus noch älteren Quellen speist?“
Richard Dawkins, Outgrowing God. A Beginner’s Guide (2019; dt. Atheismus für Anfänger):
“The Noah story comes directly from a Babylonian myth, the legend of Utnapishtim – which isn’t surprising, since Genesis was written during the Babylonian captivity. The Utnapishtim story in turn comes from the Sumerian Epic of Gilgamesh. Arguably the world’s oldest work of literature, it was written two thousand years earlier than the Noah story.”
Für Harald Lesch mag dies eine Bagatelle sein, wo der bekannte Astrophysiker(!) uns doch schon gefälschte Alien-Mumien als ungelöstes Rätsel präsentierte, doch zumindest seine Co-Autorin, die Fernsehjournalistin (nicht Altertumswissenschaftlerin!) Gisela Graichen, hätte es möglicherweise besser wissen sollen. Und gehen wir von Richard Dawkins’ (zweifelhafter) Datierung der biblischen Sintflutgeschichte in die Zeit des Babylonischen Exils aus (d.h. das 6. Jh. v. Chr.), dann müsste sein „sumerisches“ Gilgamesch-Epos etwa um 2600‒2500 v. Chr. entstanden sein.
So omnipräsent sind diese Falschdarstellungen, dass auch eine KI wie Aria auf die Frage nach dem ältesten Literaturwerk der Menschheit instinktiv zuallererst das Gilgamesch-Epos ausspuckt – und erst auf Nachfrage herumdrucksend zugesteht, dass es doch noch ältere sumerische Texte gibt (Meta Llama 4 dagegen beantwortet dieselbe Frage gleich halbwegs korrekt).

Was ist das Gilgamesch-Epos?
Das Gilgamesch-Epos ist nicht nur das bekannteste, sondern auch das umfangreichste erzählende Literaturwerk aus dem antiken Mesopotamien. Auf zwölf Keilschrifttafeln – so zumindest in der „kanonischen“ Version des 1. Jt. v. Chr. ‒ berichtet es in poetischer akkadischer (= babylonisch-assyrischer, nicht sumerischer!) Sprache von den Taten des mythischen Königs:
Gilgamesch, als Sohn des Königs Lugalbanda und der Göttin Ninsumun zu zwei Dritteln Gott und zu einem Teil Mensch, ist der mächtige König der Stadt Uruk. In seiner Hybris knechtet er seine Untertanen, bis deren Schreie zu den Göttern im Himmel dringen. Daraufhin erschaffen diese einen Wildmenschen namens Enkidu als Gegner für Gilgamesch. Die beiden kämpfen miteinander, ohne dass einer den anderen besiegen kann, und werden schließlich Gefährten. Zusammen reisen sie zum Zedernwald in den Libanon und kämpfen dort gegen den übernatürlichen Wächter Ḫumbaba. Nach ihrer Heimkehr jedoch weist Gilgamesch die Avancen der Stadtgöttin Ištar zurück, woraufhin diese den mächtigen Himmelsstier entfesselt. Gilgamesch und Enkidu können den Stier töten, doch zur Strafe schicken die Götter eine Krankheit, welche Enkidu dahinrafft. Angesichts des Todes seines Freundes stürzt Gilgamesch in eine tiefe Sinnkrise und beschließt, die Unsterblichkeit zu suchen. Nach einem Weg voller Abenteuer gelangt er zu Uta-napištim, dem Helden der Sintflut, welchem die Götter einst ewiges Leben verliehen. Dieser berichtet Gilgamesch von der Sintflut und rät ihm, dass es ein Kraut gebe, das einen Menschen verjüngen kann. Gilgamesch findet dieses, doch wird es ihm kurz darauf von einer Schlange gestohlen. So kehrt Gilgamesch nach Uruk zurück und erkennt, dass sein Erbe allein – seine Großtaten, die von ihm errichtete Stadtmauer und die urzeitliche Ritualweisheit, welche er von Uta-napištim erlangte – ihm eine Form der Unsterblichkeit verleihen wird.

Der Name Gilgamesch ist bereits in frühdynastischen Götterlisten um 2500 v. Chr. als Gott verzeichnet – ob seine Gestalt ursprünglich auf eine historische Person zurückgeht, ist unbekannt. Das eigentliche Epos entstand jedoch erst in der altbabylonischen Zeit (ca. 2004‒1595 v. Chr.), deutlich nach der Zeit der Sumerer (dem 3. Jt. v. Chr.). Ihm gehen mehrere kürzere Erzählungen über Gilgamesch in sumerischer Sprache voraus (s.u.) ‒ doch von einem sumerischen Gilgamesch-Epos zu sprechen, ist ganz klar falsch.
Von der altbabylonischen Fassung sind nur eine Reihe von Fragmenten überliefert, die sich teils eng, teils lose mit der späteren Version decken. Bereits im 2. Jt. v. Chr. verbreitete sich das Epos bis ins Reich der Hethiter (in der heutigen Türkei) und die Stadt Ugarit an der Mittelmeerküste (heute Syrien) – aus beiden Ausgrabungsstätten stammen Fragmente bzw. übersetzte Passagen des Epos. Die heute bekannte Version, das Zwölftafelepos, ist dagegen erst aus dem 1. Jt. v. Chr. überliefert und wurde damals einem Autor namens Sȋn-lēqe-unnini zugeschrieben. Diese Fassung, welche fast allen heutigen Übersetzungen zugrunde liegt, lässt sich mittlerweile aus zahlreichen Manuskripten fast vollständig rekonstruieren.
Seit seiner Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert reizte das Gilgamesch-Epos zu zahlreichen Analysen und Interpretationen, von der offensichtlichen Parallele zur biblischen Sintflutgeschichte über psychologische Interpretationen bis zur modernen Mythos- und Ritualforschung. Mehr als jedes andere altorientalische Literaturwerk wurde das Gilgamesch-Epos auch außerhalb der assyriologischen Forschung in Kunst, Popkultur und Populärwissenschaft rezipiert.
Die aktuellste englische Edition mit Übersetzung stammt von Andrew George und findet sich online in der electronic Babylonian Library (eBL L.I.4); wissenschaftliches Standardwerk ist weiterhin die zweibändige Monografie von George (2003). Als beste deutsche Übersetzung gilt jene von Stefan Maul (2005).
Wie bereits betont, stammt die früheste Fassung des Gilgamesch-Epos aus der altbabylonischen Zeit. Damit steht es jedoch keinesfalls am Anfang der mesopotamischen Literaturgeschichte. Vielmehr sind mythisch-literarische Texte in sumerischer Sprache bereits viele Jahrhunderte früher bezeugt.

Literatur vor Gilgamesch
Um 3500‒3300 v. Chr. (späte Uruk-Zeit) wird in der Stadt Uruk in Südmesopotamien die Schrift erfunden, basierend auf noch älteren Traditionen von Zählsteinen und Zahltafeln. Diese Schrift codiert zunächst noch keine vollständigen Sätze, sondern nur einzelne Begriffe und Zahlen („20 Schafe“). Gebraucht wird sie nicht für Literatur, sondern für einfache Abrechnungen im Kontext der Verwaltung. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte entwickeln die archaischen Zeichen sich weiter zur Keilschrift, die schließlich auch in der Lage ist, gesprochene Sprache wiederzugeben.
Ab der späten frühdynastischen Zeit (ca. 2500 v. Chr.) liegen erstmalig erzählende Texte mythischen Inhalts in sumerischer Sprache vor, welche vor allem als Ritualtexte im Tempelkult dienten. Hierzu zählen etwa die Hymne auf das Heiligtum Keš (Wilcke 2006; ETCSL 4.80.2), der Barton-Zylinder (vermutlich ein frühes Klagelied; Lisman 2013, 30 f; ders. 2017) sowie das Fragment eines literarisch gestalteten Schöpfungsmythos (AO 4153 = Sjöberg 2002; Lisman 2013, 27‒30); mit den sog. Zamim-Hymnen (Krebernik/Lisman 2020) liegt bereits eine umfangreiche Sammlung von Hymnen an verschiedene Götter vor. Hinzu kommen zahlreiche weitere, meist kurze und oft nur fragmentarisch erhaltene Texte mythisch-religiösen Inhalts, welche durch eine abweichende Schreibweise „verschlüsselt“ sind, wobei Zeichen durch andere Zeichen ersetzt wurden, die sog. UD.GAL.NUN-Texte. Manche von diesen – etwa das Fragment IAS 114 mit dem Beginn eines Schöpfungsmythos (Lisman 2013, 23‒25) – enthalten mythische Erzählungen. Aus der Stadt Ebla an der syrischen Mittelmeerküste stammen mehrere mit sumerischen Zeichen geschriebene Texte in eblaitischer Sprache (einem westsemitischen Dialekt), darunter Hymnen an den Sonnengott Utu/Šamaš und die Schreibergöttin Nissaba (Krebernik 1992). All diese Texte können somit als die ältesten Literaturwerke des antiken Mesopotamien gelten. In dieser Zeit wird der Name Gilgamesch bereits in Götterlisten wie jener aus Fāra erwähnt (George 2003, 71 ff), narrative Texte über ihn liegen jedoch noch nicht vor. Eine fragmentarische Erzählung über Gilgameschs Eltern Lugalbanda und Ninsumun (Jacobsen 1989) könnte von dessen Geburt handeln, doch in dem erhaltenen Manuskript taucht der Name Gilgamesch nicht auf (George 2003, 5).
Um 2350 v. Chr. gelingt es Sargon von Akkad, ganz Mesopotamien zu erobern und erstmalig in einem zusammenhängenden Reich zu vereinen. Seine Tochter En-ḫedu-ana wird als Hohepriesterin des Mondgottes Nanna in der sumerischen Stadt Ur eingesetzt. Sie gilt als erste namentlich bekannte Autorin oder Autor der Weltliteratur: Von ihr stammen die Hymnen Nin me šara (ETCSL 4.07.2) und Innin ša gura (ETCSL 4.07.3) an die Göttin Innana sowie die sog. Tempelhymnen (ETCSL 4.80.1), eine Sammlung von Preisliedern an alle Tempel des Akkad-Reiches. Diese Texte sind zwar nur in Abschriften aus der Altbabylonischen Zeit überliefert, doch verschiedene stilistische und inhaltliche Argumente sprechen dafür, dass ihre ursprünglichen Fassungen tatsächlich aus der Zeit und Hand der En-ḫedu-ana stammen dürften.
Nach dem Untergang des Akkadischen Reiches folgt die neusumerische Zeit (ca. 2164‒2004 v. Chr.), wobei Mesopotamien im 21. Jh. v. Chr. von der 3. Dynastie von Ur beherrscht wird. Von Gudea, dem Stadtfürsten von Lagas, stammen nicht nur zahlreiche Inschriften, sondern auch der längste erhaltene literarische Text in sumerischer Sprache, das auf zwei Tonzylindern überlieferte Preislied über den Bau des Tempels Eninnu (sog. Gudea-Zylinder = ETCSL 2.1.7). Auch von den Königen der 3. Dynastie von Ur sind zahlreiche kunstvoll gestaltete Hymnen überliefert. In manchen von diesen beziehen sich die Könige explizit auf Gilgamesch als ihren mythischen Verwandten.
Auf das Ende der 3. Dynastie von Ur folgt die altbabylonische Zeit (ca. 2004‒1595 v. Chr.). Die meisten mythisch-literarischen Texte in sumerischer Sprache, die uns heute bekannt sind, sind aus dieser Zeit überliefert – darunter zahlreiche Preislieder an Götter, Könige und Tempel (teils in Form mythischer Erzählungen), Klagelieder um zerstörte Städte sowie die ersten „Heldenepen“: Die Erzählungen Enmerkara und der Herr von Arata (ETCSL 1.8.2.3) sowie Enmerkar und En-suḫkeš-ana (ETSL 1.8.2.4) sowie das zweiteilige Lugalbanda-Epos (ETCSL 1.8.2.1 und 1.8.2.2) berichten ausführlich von den Heldentaten der unmittelbaren Vorgänger Gilgameschs als Herrscher von Uruk. Zudem liegen mehrere sumerische Erzählungen über den König Gilgamesch vor, die später teilweise Eingang in das akkadische Gilgamesch-Epos fanden: Gilgamesch und Akka (ETCSL 1.8.1.1), Gilgamesch und der Himmelsstier (ETCSL 1.8.1.2), Gilgamesch und Ḫuwawa (Version A: ETCSL 1.8.1.5; Version B: ETCSL 1.8.1.5.1), Gilgamesch, Enkidu und die Unterwelt (ETCSL 1.8.1.4) sowie Gilgameschs Tod (ETCSL 1.8.1.3). Mindestens drei Fragmente von Gilgamesch-Erzählungen, darunter ein Manuskript von Gilgamesch und der Himmelsstier sowie eine sonst unbekannte und bislang unpublizierte Erzählung namens Gilgamesch und die junge Frau, stammen bereits aus der Zeit der 3. Dynastie von Ur (George 2003, 7). Der Rest der Gilgamesch-Texte ist in altbabylonischen Manuskripten überliefert, könnte aber ebenfalls bis in die neusumerische Zeit zurückgehen.
Der führende Gilgamesch-Forscher Andrew George bringt es auf den Punkt:
„First, it grows ever clearer that there was no unified Sumerian Epic of Gilgameš nor even a cycle of related texts, but only five separate and independent compositions. The fashioning around the character of Gilgameš of a majestic epic poem, with its great, uniting themes of power and kingship, wilderness and civilization, friendship and love, victory and arrogance, death and life, man and god ‒ this was a Babylonian achievement.” (George 2003, 19 f)
Im Laufe der altbabylonischen Zeit entstehen nun auch erste größere Literaturwerke in akkadischer Sprache, darunter das Atram-ḫasīs-Epos (eBL L.I.1), das Agušaja-Lied (SEAL 7493 und 7494) und die erste, in Fragmenten überlieferte Fassung des Gilgamesch-Epos. Die frühesten erhaltenen altbabylonischen Manuskripte des Epos, darunter die Pennsylvania- und Yale-Tafel sowie ein Fragment in Philadelphia, entstanden wohl im 18. Jh. v. Chr. oder wenig früher (George 2003, 161, 216), wobei sie in Teilen von den früheren sumerischen Erzählungen beeinflusst sind. Das Epos selbst – oder zumindest frühe Varianten davon – dürfte eine gewisse Zeit früher komponiert worden sein, jedoch nicht vor der altbabylonischen Zeit (d.h. erst im frühen 2. Jt. v. Chr.).

Wo ist das Problem?
Das Gilgamesch-Epos ist nicht sumerisch (sondern nach der Zeit der Sumerer in akkadischer Sprache geschrieben) ‒ und es ist bei weitem nicht das älteste Literaturwerk der Menschheit: Ihm gehen etliche (größtenteils fragmentarische) Texte der späten frühdynastischen Zeit um viele Jahrhunderte voraus, ebenso die Meisterwerke der En-ḫedu-ana und wahrscheinlich ein großer Teil der gesamten, überwiegend altbabylonisch überlieferten sumerischen Literatur. Viele dieser Werke sind ebenfalls in einem hochliterarischen, ausgefeilten Stil verfasst und enthalten umfangreiche mythische Erzählungen. Wer das Gilgamesch-Epos als früheste überlieferte Erzählung der Welt bezeichnet, ignoriert fast ein Jahrtausend an schriftlich bezeugter Literaturgeschichte.
Ob es sich zumindest um das älteste (Helden-)Epos handelt, wie oft behauptet, hängt von der Definition des Begriffs Epos ab. In der Altorientalistik ist dieser durchaus umstritten, da eine literarische Kategorie aus dem alten Griechenland nur bedingt den Genres des antiken Mesopotamien gerecht wird, doch wird zumindest das sumerische Lugalbanda-Epos in der Forschung regelmäßig als solches bezeichnet. Auch die Texte Enmerkara und der Herr von Arata, Enmerkar und En-suḫkeš-ana sowie die sumerischen Gilgamesch-Erzählungen lassen sich durchaus als Kurzepen bezeichnen, auch wenn das akkadische Gilgamesch-Epos all diese Texte an Umfang und inhaltlicher Komplexität bei weitem überragt.
Letztendlich ist das Problem weniger, dass heutige Menschen ein antikes Literaturwerk um einige Jahrhunderte falsch datieren oder gar der falschen (sumerischen) Kultur zuschreiben, sondern vielmehr, was dies über die historische Illiteralität heutiger Publizisten aussagt: Weder die Herausgeber (nicht Autoren!) von Gilgamesch-Textausgaben, noch ‒ was weitaus schlimmer ist! ‒ etablierte Wissenschaftskommunikatoren mit hoher Reichweite machen sich die Mühe, die elementarsten Grundlagen des Themas zu durchdringen, bevor sie darüber in gedrucktem Wort publizieren.
Die eigentliche Ursache aber liegt natürlich tiefer: Das antike Mesopotamien ist im breiten Allgemeinwissen kläglich unterrepräsentiert, bestenfalls beschränkt auf wenige Schlagwörter: Turm zu Babel, Babylon als politische Metapher, Gilgamesch-Epos, Sumerer als erste Zivilisation, Keilschrift und Zikkurats. Vor allem aber fehlt im Allgemeinwissen jede Vorstellung des historischen Rahmens: Dreitausend ist so gut wie sechstausend Jahre, wahlweise vor heute oder vor Christus, Babylonisch ist gleich Sumerisch und Gilgamesch der einzige bekannte Name. All das lässt sich unter der Datierung „uralt“ zusammenfassen (das ist sogar noch älter als „damals“), eine nähere Unterscheidung gibt es nicht. Schuld daran sind natürlich weniger die Leser, die es nicht besser wissen, als vielmehr ein gesamtgesellschaftlicher Mangel an guter Populärwissenschaft über den Alten Orient. Wenn überhaupt, beschränken sich populäre Darstellungen meist auf wenige prominente (vor allem akkadische) Literaturwerke wie das Gilgamesch-Epos oder das „babylonische Weltschöpfungsepos“ Enūma eliš und verbinden dies fälschlich mit dem diffusen Halbwissen von den Sumerern als ältester Zivilisation, ohne die tatsächlich frühesten Texte zu kennen.
Immerhin, dies sei zur Ehrenrettung einem der zuvor kritisierten Autoren zugestanden: In einer weiteren e-book-Ausgabe von Outgrowing God scheint Richard Dawkins (nach energischer Kritik durch den Altorientalisten George Heath-Whyte und verschiedene Blogger?) die fragliche Stelle einschließlich anderer historischer Fehler und Ungenauigkeiten korrigiert zu haben:
„The Noah story comes directly from a Babylonian myth, the legend of Utnapishtim — which isn’t surprising, since Genesis was written during the Babylonian captivity. The story comes in the Epic of Gilgamesh, which tells how the legendary Sumerian King Gilgamesh, on his quest to escape death, heard about the great flood from Utnapishtim’s own lips.“
Es lassen sich schwerlich vertiefte Kenntnisse der sumerisch-babylonischen Literaturgeschichte von einem jeden Medienschaffenden erwarten, doch es wäre kaum zu viel verlangt, wenn wenigstens die elementarsten Daten nicht um viele Jahrhunderte und ganze Kulturen verfehlt würden. Wer würde es schon wagen, von einer ägyptischen Ilias, einem lateinischen Hamlet oder einem altnordischen Faust zu schreiben? Schließlich wäre auch zu wünschen, dass die anderen altorientalischen Literaturwerke vor und neben Gilgamesch mehr Beachtung fänden – wenn schon nicht gelesen, so könnte doch zumindest ihre Existenz anerkannt werden.

Literatur
Dawkins, R. 2019: Outgrowing God. A Beginner’s Guide
George, A. 2003: The Babylonian Gilgamesh Epic. Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts. Volume I, Oxford/New York.
George, A. R. 2022: Poem of Gilgameš. With contributions by E. Jiménez and G. Rozzi. Translated by Anmar A. Fadhil, Andrew R. George and Wasim Khatabe. electronic Babylonian Library. https://doi.org/10.5282/ebl/l/1/4
Graichen, G. / Lesch, H. 2022: Liegt die Antwort in den Sternen?: Wie Astrophysik die Rätsel der Archäologie löst, Berlin.
Jacobsen, T. 1989: Lugalbanda and Ninsuna. JCS 41/1, 69‒86. https://doi.org/10.2307/1359743
Krebernik, M. 1992: Mesopotamian Myths at Ebla: ARET 5, 6 and ARET 5, 7, in: P. Fronzaroli (Hg.), Literature and Literary Language at Ebla. Quaderni di Semitistica 18, Florenz, 63‒149.
Krebernik, M. / Lisman, J. J. W. 2020: The Sumerian Zame Hymns from Tell Abū Ṣalābīḫ. With an Appendix on the Early Dynastic Colophons. dubsar 12, Münster.
Lisman, J. 2013, At the beginning… Cosmogony, Theogony and Anthropogeny in Sumerian Texts of the Third and Second Millennium BCE, Leiden.
Lisman, J. J. W. 2017: The Barton Cylinder: A Lament for Keš? JEOL 46, 145‒178.
Maul, S. M. 2005: Das Gilgamesch-Epos. Neu übersetzt und kommentiert von Stefan M. Maul, München.
Sjöberg, Å. W. 2002: In the Beginning, in: T. Abusch (Hg.), Riches Hidden in Secret Places. Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen, Winona Lake, 229‒248.
Wilcke, C. 2006: Die Hymne auf das Heiligtum Keš, in: P. Michalowski / N. Veldhuis (Hg.), Approaches to Sumerian Literature. Studies in Honour of Stip (H.L.J. Vanstiphout). CM 35, Leiden, 201–237.
Siehe auch:
Das Gilgamesch-Epos nach Erich von Däniken
Eternals und der Alte Orient
Rezension: Sarwat Chadda – Sikander gegen die Götter. Das Schwert des Schicksals
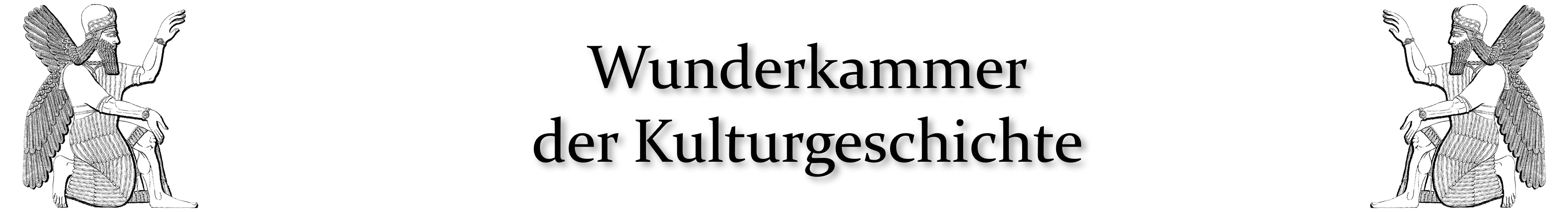

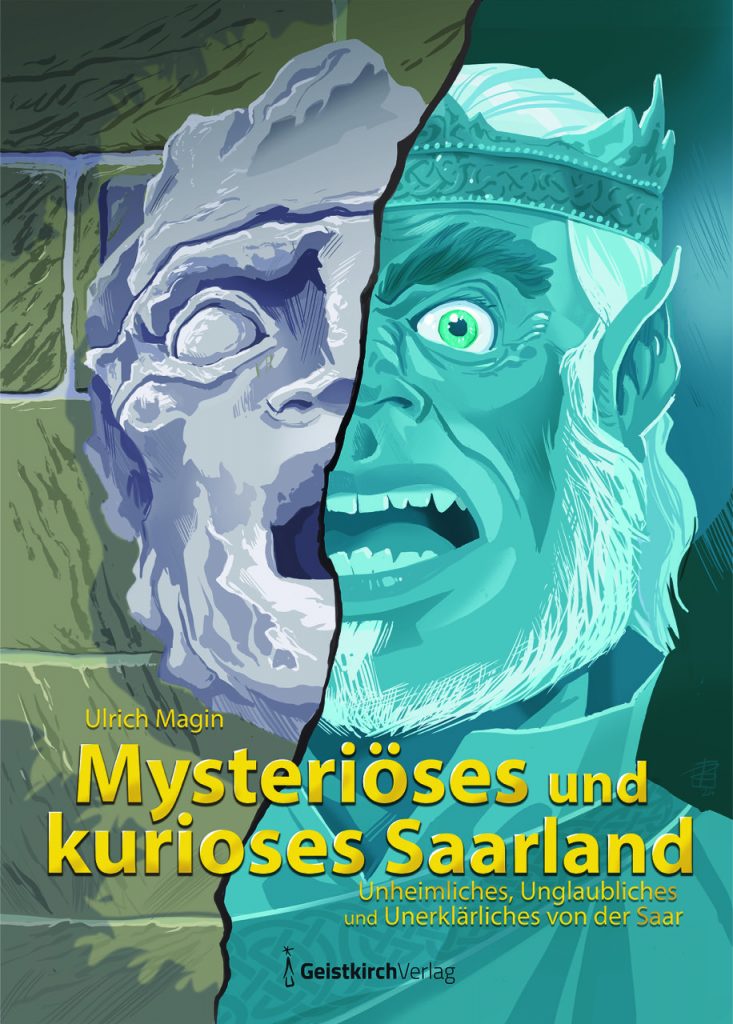






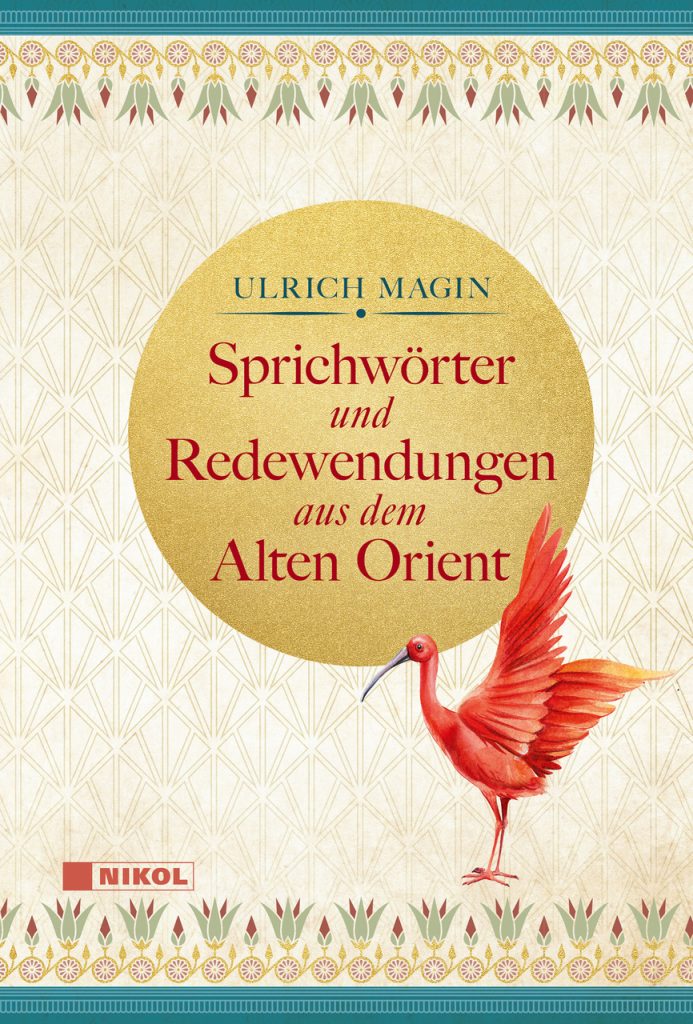
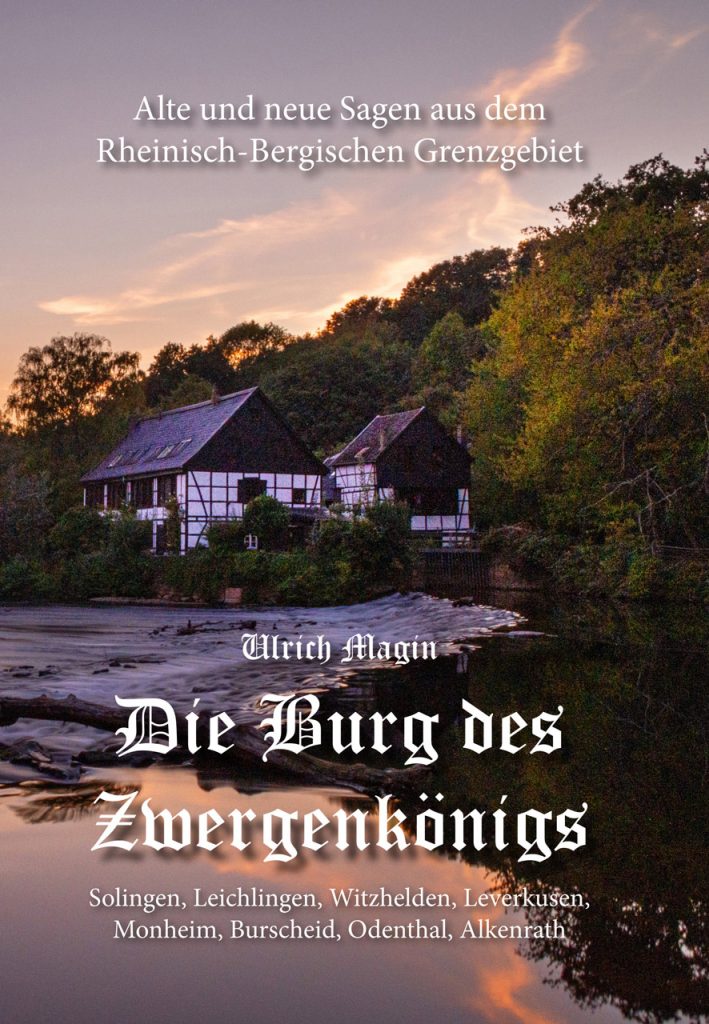

Ich habe vor Kurzem die Reclam-Ausgabe gelesen, weil ich das Gilgamesch-Epos schon immer mal lesen wollte. Mir war nicht bewusst, dass es weitere Texte aus der Gegend gibt, die tatsächlich noch ein paar mehr Jahrhunderte auf dem Buckel haben, weil ich nur die Gilgamesch-Erzählung aus dieser Zeit vom Hörensagen kannte. Dahe rvielen Dank für die Aufklärung und die Angaben zu weiterem Lesematerial. Da werde ich mit Freuden reinschauen.
In der Entdeckung des Himmels von Harry Mulisch wird das Gilgamesch-Epos von einem Protagonisten auch als älteste Geschichte der Menschheit bezeichnet. Das führte mich zu Ihrer Website. Ich würde mich damit sehr gern weiter beschäftigen. Können Sie mir Literatur (populärwissenschaftliche) zur Geschichte des Alten Orients empfehlen? Vielen Dank!
Liebe Frau Ziegenbalg,
freut mich sehr, dass Sie aus dem Artikel etwas mitnehmen konnten!
An populärwissenschaftlichen Einführungsbüchern gibt es:
Manfred Krebernik: Götter und Mythen des Alten Orients (knapper Überblick zu Göttern, Mythen etc.)
Stephen Bourke: Der Nahe Osten (allgemeinverständlicher, reich mit Originalfunden illustrierter Überblicksband – war auch mein erstes Buch zum Thema; antiquarisch erhältlich)
Dietz-Otto Edzard: Geschichte des antiken Mesopotamien (historischer Überblick, nicht bebildert)
Daneben gibt es noch ein paar dünne Überblicksbände der Becks-Wissen-Reihe: „Mesopotamien: Die antiken Kulturen zwischen Euphrat und Tigris“; „Sumerer und Akkader“; „Die Babylonier“; „Die Assyrer“; „Das frühe Persien“.
Originaltexte in Übersetzung:
Konrad Volk (Hg.): Erzählungen aus dem Land Sumer (diverse sumerische literarische Texte in deutscher Übersetzung, jeweils mit Einführung)
Sabina Franke (Hg.): Als die Götter Mensch waren (diverse akkadische literarische Texte in deutscher Übersetzung, u.a. das Atram-hasis-Epos)
Stefan M. Maul (Üs.): Das Gilgamesch-Epos (beste deutsche Übersetzung)
Adrian C. Heinrich (Üs.): Der babylonische Weltschöpfungsmythos Enuma Elisch (aktuelle deutsche Übersetzung)
The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature: https://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/etcslbycat.php (alle wichtigen sumerischen literarischen Texte im Original und englischer Übersetzung)
electronic Babylonian Library: https://www.ebl.lmu.de/corpus (akkadische literarische Texte im Original und englischer Übersetzung, u.a. Gilgamesch, Enuma elisch etc.; wird noch ausgebaut)
Ich empfehle auch immer Ausstellungskataloge, da man dort vielfältige allgemeinverständliche Beiträge mit oft hoher Qualität zusammen mit vielen Bildern von Originalobjekten findet. Antiquarisch erhältlich sind z.B. „Babylon: Wahrheit“, „Die Hethiter und ihr Reich: Das Volk der 1000 Götter“ und „Das vorderasiatische Museum Berlin“.
Ansonsten gibt es auf Deutsch leider nicht so viel, eher noch auf Englisch. Grundsätzlich würde ich mich immer an aktuelle (ca. nach 2000) Publikationen von Autoren halten, die selbst in dem Bereich forschen (notfalls Namen googeln) – daneben gibt es leider auch viele außerakademische Autoren, deren Qualität von oberflächlich und veraltet bis völligem Blödsinn reicht. Lassen Sie am besten die Finger von allem, wo Zecharia Sitchin oder Anunnaki draufsteht. Und die Bücher von Samuel Noah Kramer, die immer noch kursieren („Geschichte beginnt in Sumer“, „Sumerian Mythology“) waren zwar ihrerzeit gut, sind heute aber hoffnungslos veraltet. Wenn Sie sich tiefer mit der Funktionsweise mesopotamischer Mythologie und Religion beschäftigen möchten, empfehle ich das neue Buch von Prof. Annette Zgoll: „Rituale. Schlüssel zur Welt hinter der Keilschrift“ (Open Access beim Verlag: https://univerlag.uni-goettingen.de/handle/3/isbn-978-3-86395-671-4?locale-attribute=de). Das ist zwar nicht mehr wirklich populärwissenschaftlich – ansonsten gibt es aber auch mehrere Vorträge und Vorlesungen von ihr bei YouTube.
Fragen Sie gerne weiter nach, wenn Sie etwas Bestimmtes interessiert! 😉
,,Das antike Mesopotamien ist im breiten Allgemeinwissen kläglich unterrepräsentiert“
Genau wie die neolithische Revolution. Deshalb haben ja populäre Evolutionsmythen so leichtes Spiel, die uns weismachen wollen, dass die ,,Steinzeit“ nie geendet hätte.
Dem gängigen Geschichtsbild nach könnte man glatt denken, die alten Griechen wären die ersten Menschen gewesen; Denn wie oft hört man, dass ,,schon die alten Griechen“ dieses gehabt und jenes gemacht hätten.
Fakt ist: Alles, was den (modernen) Menschen ausmacht, entstand erst vor einigen tausend Jahren, in der jüngeren Vergangenheit. Für unsere noch früheren Vorfahren sah die Welt ganz anders aus.
Zurück zum Gilgamesch-,,Epos“: Schon die fantastischen Ausschmückungen entlarven es als Erfindung der Spätzeit. Es ist nicht nur nicht die älteste Erzählung, sondern besitzt auch keinerlei literarische Authentizität, geschweige denn historische.