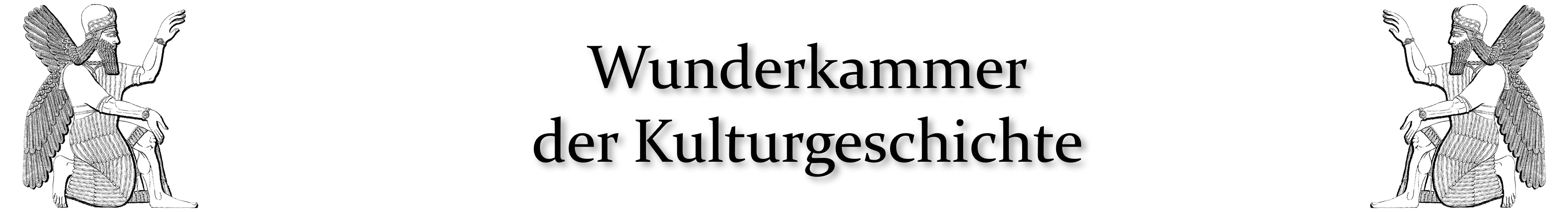Karl May und die Indianer – Eine über 110 Jahre alte Stimme zur Winnetou-Debatte
Karl May (l.) und J. Ojijatheka Brant-Sero (r.)
Karl May behauptete gegen Ende des 19. Jahrhunderts, er selbst sei Old Shatterhand gewesen und habe alle Abenteuer, die er in seinen Büchern schildert, selbst erlebt. Diese Fiktion hielt er bis in die zehner Jahre des 20. Jahrhunderts aufrecht, auch wenn das immer schwerer wurde.
Eine Reaktion auf seine Münchhausiaden ist ein Brief des Indianers John Ojijatheka Brant-Sero an deutsche Zeitungen, der sich über die falsche Darstellung der Bewohner Nordamerikas aufregte. Der Brief wurde von Feinden Karl Mays lanciert, es handelt sich jedoch um eine authentische indigene Stimme, wenn auch der Verfasser zum Verdienst seines Lebensunterhalts gezwungen war, selbst den Klischees zu genügen.[1]
Das Leipziger Tageblatt veröffentlichte das Schreiben am 29. Juni 1910:
Ein Indianer über die Indianer-Literatur
Der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung“ ging folgende originelle Zuschrift zu, die Anspruch auf allgemeine Beachtung hat:
„Während der wenigen Monate, die ich nun in Deutschland bin, fiel es mir immer wieder auf, welche Massen von blutrünstiger Indianer-Literatur in den Schaufenstern der Papiergeschäfte und bei den Zeitungshändlern ausgestellt sind. Man sieht da auf den Titelbildern Indianer, wie sie Bleichgesichter skalpieren; Indianer, die weiße Frauen und Kinder morden. Bauernhäuser abbrennen und andere Schandtaten begehen. Da ich das Deutsche nicht gut beherrschte, vermochte ich leider nicht, diese sonderbare Literatur zu studieren. Aber das Glück wollte es, daß mir in dieser Beziehung die Augen geöffnet wurden. Ein deutscher Junge, mit dem ich Freundschaft geschlossen habe und der auf diese Freundschaft außerordentlich stolz ist. brachte mir neulich ein Indianerbuch von Carl May, den er schwärmerisch verehrt. Es war der 4. Band von „Winnetou“, der erst dieser Tage erschienen ist. Nun wohl, ich muß es gestehen, bis jetzt hatte der Name Carl May einen guten Klang für mich, denn man hatte mir erzählt, daß er ein Freund der Indianer und ein Kenner ihrer Sprachen sei. Ich hatte sogar im letzten Winter an ihn einen Brief geschrieben, in dem ich den Wunsch äußerte, mit ihm bekannt zu werden, denn ich trug Verlangen, mich endlich wieder einmal in meiner Muttersprache mit jemand über Indianerverhältnisse auszusprechen.
Frau May antwortete: „Mein Mann ist krank. Wer gab Ihnen unsere Adresse?“ Mein zweiter Brief kam uneröffnet zurück. Man hatte die Annahme verweigert.
Hatte man Angst, mich, den Indianer, zu empfangen? Sie werden es verstehen, daß ich nach alledem sehr neugierig war, den Inhalt des Mayschen Buches, das mir mein junger Freund brachte, kennen zu lernen. Zum Glück fand sich jemand, der mir das Buch übersetzte. Jetzt, nachdem ich das Buch kenne, hat sich meine Achtung vor Carl May verflüchtigt. Niemals in meinem ganzen Leben kam mir – ich bitte um Verzeihung – so eine dämliche Karikatur meines Volkes vor Augen.
Gestatten Sie mir einige Worte über das Buch, das Ostern 1910 vollendet wurde und dessen Handlung, wie der Verfasser andeutet, in den Jahren 1907 und 1908 spielt. Herr May erzählt seinen Lesern in dem Roman von einem Plan der vereinigten Staaten-Indianer, ein Riesendenkmal zu errichten für seinen edlen Freund, den großen Apachenhäuptling Winnetou. Das Denkmal soll auf dem Berge Winnetou im Felsengebirge zu stehen kommen. Gegen den Plan waren, so erzählt uns Carl May, vier indianische Nationen: die Sioux, Commanches, Utahs, Kiowas, zusammen 4000 Reiter in Kriegsbemalung. Diese vier Nationen hatten sich im geheimen verschworen, bei der Denkmalsenthüllung, die Apachen niederzumachen. Warum das? Als Strafe für die Apachen-Anmaßung und -Eitelkeit, die darin bestehen soll, daß für einen Apachen ein Denkmal errichtet wird. Aber es kommt alles anders. Am Tage der Denkmalsenthüllung verschlingt die Erde das Monument. Es war nämlich über einer Riesenhöhle errichtet worden, die durch die große Belastung des Denkmals zum Teil einstürzte. In dieser Höhle hatten sich nun aber auch die vorerwähnten 4000 indianischen Verschwörer versammelt. Jetzt saßen sie wie die Mäuse in der Mausefalle. Aber habe keine Angst. Der große Heros Carl May, der schon unzählige Heldentaten in seinem Roman vollführte, erscheint auf der Bildfläche und rettet alle 4000.
Ruhm und Ehre Herrn Carl May, der, abgesehen von dieser Heldentat, wie er in seinem Roman weiter behauptet, das Christentum den armen, armen Indianern gebracht hat.
Erlauben Sie mir, an diesen Roman mit der Sonde der Kritik heranzutreten. Ich war zweiter Vizepräsident der historischen Gesellschaft von Ontario und kenne die indianischen Angelegenheiten ziemlich gut; ich kenne auch die hervorragendsten Indianer aller Stämme des nordamerikanischen Kontinents. Aber ich habe niemals von einem Apachenhäuptling Winnetou gehört. Ich habe niemals von einem weißen Apachenhäuptling namens Carl May oder Old Shatterhand gehört. Ich habe niemals etwas verlauten hören von einem Berg Winnetou oder von einer indianischen Massenansammlung, wie die in dem Roman bei der Denkmalsenthüllung beschriebene. Daß Carl May das Christentum in meinem Volke einführte, ist eine ganz neue Offenbarung für mich. Um die Sache kurz zu machen: Der Winnetou-Roman ist zu dumm, als daß er eine ernstliche Prüfung aushielte.
Es ist völlig unmöglich, daß viele Tausende von Indianern, noch dazu von verschiedenen Nationen, ihre ihnen zugewiesenen Gebiete (Reservationen) verlassen könnten und 600 Kilometer weit ohne Einschreiten der Behörden wandern dürften. Wenn der Fall wirklich einträte, würde der betreffende Staat sofort seine Miliz aufbieten, und selbst Bundestruppen würden nach wenigen Tagen der Völkerwanderung ein Ende machen. Der Hinweis von Carl May, daß 4000 Commanchen, Kiowas und andere Stämme die Apachen niederzumachen trachteten, zeigt eine erschreckende Unwissenheit über die heutigen Indianerverhältnisse. Die Stammesfehden haben längst aufgehört. Die ehemaligen Krieger sind heute Bauern und gehen in diesem prosaischen Beruf voll und ganz auf. In ihrer freien Zeit lesen sie gute Schriften und nicht, wie die deutschen Knaben, blutrünstige Indianer-Literatur. Carl May wiederholt immer wieder und wieder die Redensart von der armen, armen aussterbenden Indianerrasse. Er spricht von den düstern Indianeraugen, die so ernst und traurig blicken, wie die Augen aller sterbenden Völker. Die Wahrheit aber ist, daß sich die Indianer keinesfalls in einem bejammernswerten Zustand befinden: noch denken sie daran, sich Rachegedanken hinzugeben über die schlechte Behandlung, die ihnen früher zuteil wurde. Es fällt ihnen auch gar nicht ein, auszusterben; im Gegenteil, die nordamerikanischen Indianer nehmen zu an Zahl und Reichtum. Den besten Beweis, daß Carl May, der in seinem Winnetou-Roman behauptet, zu den bestinformierten Indianerschriftstellern zu gehören, keine Ahnung von Indianersitten, dem Seelenleben und dem Charakter des Indianers hat, bilden seine Kußszenen. Die gewöhnliche Form der Begrüßung in dem Mayschen Winnetou-Roman ist der Kuß. Es ist höchst merkwürdig, wieviel Küsse im Winnetou-Roman ausgetauscht werden. Da gibt es Küsse auf die Stirn, Küsse auf die Wangen, Küsse auf die Hände. Küsse auf den Kleidersaum, Kuß, Kuß, Küsse – eine allgemeine Abschleckerei. Jeder, der nun mit Indianern zusammenkam, muß aber wissen, daß der Kuß dem Indianer unbekannt ist. Indianer würden eher kämpfen als küssen.
Der Maysche Indianerroman ist ein lächerlicher Witz, aber die Sache hat auch ihre ernste Seite. Es kann uns Indianern nicht gleichgültig sein, ob wir in der ausländischen Literatur als skalpierende blutdürstende Wilde geschildert werden. Ich, als ein Vollblut-Mohawk-Indianer (Caniengahaka) protestiere hiermit gegen diese bösartige Verleumdung, die mein Nationalgefühl auf das tiefste verletzt, und ich hoffe, daß der große Indianerkongreß, der Ende Juni in Muscogee auf Indianergebiet in den Vereinigten Staaten zusammenkommt und dem ich hierüber schrieb, sich meinem Protest anschließen wird, etwa in der Form einer Resolution, die die gesamte ausländische Schauerindianerliteratur verurteilt. Der Kongreß muß nun endlich seine Stimme dagegen erheben, daß wir Indianer als Teufel innerhalb der ganzen christlichen Zivilisation verschrien werden. Das ist das, was ich dem indianischen Kongreß ans Herz gelegt habe betreffs der deutschen Penny dreadful-Literatur. Nun noch ein paar Worte zum Schluß. Der indianische Geist ist nicht gebrochen, obgleich die Vereinigten Staaten 4 Milliarden Mark für diesen Zweck (Kriegslasten) im letzten Jahrhundert ausgaben. Der Fortschritt in den indianischen Reservationen ist unbestreitbar, wie die Jahresberichte von Kanada und der Vereinigten Staaten ausweisen. Die Indianerschulen nehmen einen schnellen Aufschwung. Auch auf dem Gebiete des Sportes wetteifern die indianischen Hochschulen mit den weißen Hochschulen in gemeinsamen Sportfesten, denen jährlich Zehntausende von Amerikanern anwohnen. Den guten Leutchen, die die Indianer heute noch für Wilde und eine aussterbende Rasse halten, würde es wahrscheinlich gehen, wenn sie nach Amerika kämen, wie jenem Londoner Ingenieur, der auf den Indianer-Reservationen Wigwams mit hin- und herschaukelnden Skalpen zu finden trachtete, aber nur friedliche indianische Bauernhäuser vorfand, die sich in nichts von Yorkshire Bauernhäusern unterschieden. Wer in Europa Indianerstudien treiben will, gehe in die Museen, aber halte sich die indianische Schauerliteratur vom Leibe.J. Ojijatheka Brant-Sero.
Leipziger Tageblatt, 29.06.1910
[1] vgl. den komplexen Sachverhalt bei Karl-May-Wiki: John Ojijatekha Brant-Sero