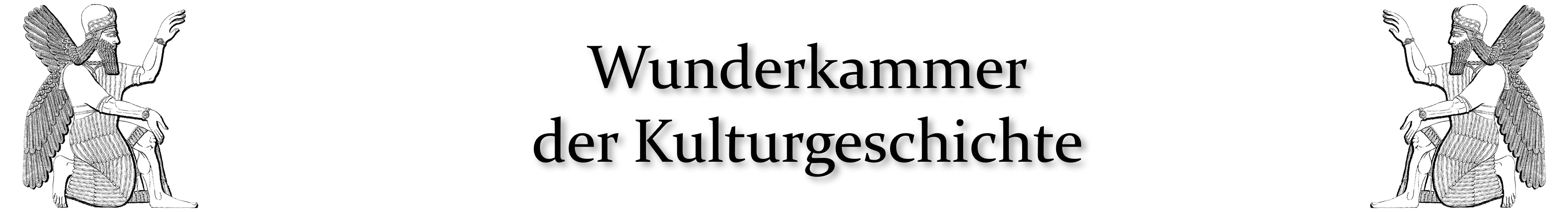Die fliegenden Leichen von Ragnit
Was tut man, wenn man von einem unheilvollen Gespenst verfolgt wird? Man bringt sich selbst um die Ecke!
Für uns heute klingt das skurril – für unsere Vorfahren war es oft das einzige Mittel, um bösen Spuk zu vermeiden. Man sollte zwar glauben, dass Geister als körperlose Wesen sich nach Belieben überallhin wenden können, doch das scheint nicht der Fall zu sein: Alle Traditionen sind sich einig, dass Gespenster sich nur in geraden Linien bewegen können. Deshalb, so fand der Kunstwissenschaftler Dr. Hermann Kern heraus, finden sich vor vielen Kirchen Labyrinthe, in denen sich die Geister einfach verlaufen müssen.
Andererseits müsste dann auf und um den Kirchhof im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los gewesen sein. Und tatsächlich: Der „Geisterweg“, berichtet der Volkskundler Carl Mengis im berühmten „Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens“ in den 1930ern, „ist immer derselbe, auf ihm begegnet man sehr oft den Geistern. Stets zieht er in gerader Linie über Berg und Tal, über Wasser und durch Sümpfe, in den Dörfern hart über die Häuser hin oder mitten durch sie hindurch. Entweder geht er von einem Friedhof aus oder endet daselbst.“ Und dem Spukweg kommt „dieselbe Eigenschaft zu wie dem Friedhof selbst, er ist ein Tummelplatz der Totengeister.“
Wer die Lage solcher Wege kannte, war offenbar gut beraten. Recht anschaulich schildert dies eine Sage aus dem ehemaligen ostpreußischen Ragnit, dem heutigen russischen Neman. Dort hieß der Geisterweg, so als befände man sich auf einem modernen Drehkreuz des Luftverkehrs, die „Leichenflugbahn“. Und das aus gutem Grund, den das „Sagenbuch des preussischen Staats“ von 1871 nennt:
„Zu Ragnit sind zwei Gottesäcker, der eine südwestlich von der Stadt für die deutsche, der andere östlich gelegene für die litthauische Gemeinde. Auf dem Striche zwischen diesen beiden Gottesäckern leidet es aber weder Baum noch Strauch, weder Haus noch Mauer, weder Zaun noch Hecke, denn die Toten, die im Leben mit einander befreundet gewesen sind, besuchen sich in stürmischen Nächten und fliegen in der Luft von einem Gottesacker zum andern. Sie fliegen aber nicht hoch über der Erde, und deshalb leiden sie keinen auch nur wenige Ellen hohen Gegenstand auf ihrem Wege.“
Offenbar kannte jeder vor Ort den Tummelplatz der Geister, aber nicht jeder glaubte an sie: „Einstmals baute ein Fremder, ohne die Warnungen der dortigen Einwohner zu achten, ein Haus auf der Südseite der Stadt, wo es also noch im Bereiche der Leichenflugbahn lag. Ehe aber das Sparrwerk aufgesetzt ward, da kam einmal eine stürmische Nacht und am Morgen lagen die starken Mauern des neuen Hauses in Trümmern, da doch etliche armselige Hütten, die wenige Schritte davonstanden, aber den Leichen nicht im Wege waren, den Sturm ohne allen Schaden ausgehalten hatten.“
Der Bauherr wollte immer noch nicht auf die Einheimischen hören: „Er ließ also das Haus noch einmal aufbauen und noch stärker und fester als das erste Mal, aber wie es wieder bis ans Dach war, trat eine stürmische Nacht ein und am Morgen lag das Haus wieder in Trümmern. Nun wich der Bauherr der Macht der Toten und baute sein Haus ein wenig seitab, so daß es nicht mehr in dem Striche zwischen den Gottesäckern lag. Dort hat es viele Nächte unbeschadet ausgehalten und steht heute noch.“
In der Vorstellung unserer Altvorderen waren die Totenwege und -flugbahnen also nicht weniger präzise als moderne Autobahnen: „Es muß aber die Flugbahn der Toten gar genaue Grenzen haben, denn einmal wollte ein Bürger von Ragnit eine Scheuer südlich von der Stadt bauen, und da er ein Sonntagskind und ihm also die Geister sichtbar waren, so beobachtete er in einer stürmischen Nacht den Flug der Toten genau und steckte sich ein Zeichen ab, damit er mit seinem Baue ihnen nicht in den Weg geriethe. Er mochte aber dabei doch um ein Paar Ellen zu knapp gekommen sein, denn als die Scheuer fertig war und in einer Nacht der Sturm tobte, da war am Morgen darauf die Ecke des einen Scheunengiebels morsch abgerissen. Alsbald ließ der Besitzer denselben einrücken und nun blieb er unbeschadet. Aber eine kleine Dachspitze der Scheuer ragt heute noch in die Flugbahn der Toten, und so oft eine stürmische Nacht ist, reißen sie dieselbe herunter, so daß der Besitzer sie wohl hundertmal im Jahre ausbessern lassen muß.“
Richtig gruselig aber wird es in dem 1917 erschienen Roman „Urte Kalwis“ der deutschen Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Clara Ratzka-Wendler (1871–1928). Darin unterhalten sich zwei Frauen, die Titelheldin Urte Kalwis und ihre Schwester Mare:
„Du kennst doch die Geschichte von dem Leichenbesuch in Ragnit? Die Großmutter Wasputtis erzählte sie uns. … Die Toten auf den Ragniter Friedhöfen, die in der Mitternachtsstunde zum Sonntag geboren wurden und die sich zu Lebzeiten gut kannten, können sich in jeder Sturmnacht besuchen. Dann schweben sie in ganz gerader Richtung von einem Friedhof zum andern. Sie sind steil aufgerichtet, und in ihren Augen sind grünliche Funken. Sie strecken ihre Hände geradeaus, und die Füße der untersten – du mußt denken, daß es Hunderte und Tausende sind – sind nur wenige Handbreit vom Boden entfernt. Sie nehmen immer nur den einen Weg, ganz geradeaus von einem Friedhof zum andern, und auf diesem Wege steht kein Haus und keine Mauer, kein Baum und kein Strauch; alles muß fallen und verdorren, was den Leichenbesuch hindern könnte.“
Damals konnte man die Leichenflugbahn bei Ragnit noch besichtigen – es war ein „breiter, freier Weg für den Leichenbesuch“. Sind vielleicht die Menhirreihen in Carnac einst auch solche Leichenflugbahnen gewesen? Das vermutet der englische UFO- und Geomantie-Forscher Paul Devereux, der die vielen geheimnisvollen, geraden Landschaftslinien, die man überall auf der Welt antrifft, für solche Geisterwege hält.
Wie dem auch sei – eine Frage beantwortet die Leichenflugbahn. Nämlich die uralte Scherzfrage, warum Geister zwar durch Wände gehen können, aber nicht im Fußboden versinken. Des Rätsels Lösung: Sie gehen nicht, sie fliegen! Und sie gehen dabei ihre eigenen Wege.
Titelbild: Weibliches Gespenst auf einer Straße (Bonnybbx, Public Domain)
Ulrich Magin lebt nahe Bonn und ist Autor des Buchs „Geheimnisse des Saarlandes: Geister – Wunder – Hinkelsteine. Über Unerklärliches und Unheimliches an der Saar“ (Geistkirch-Verlag).