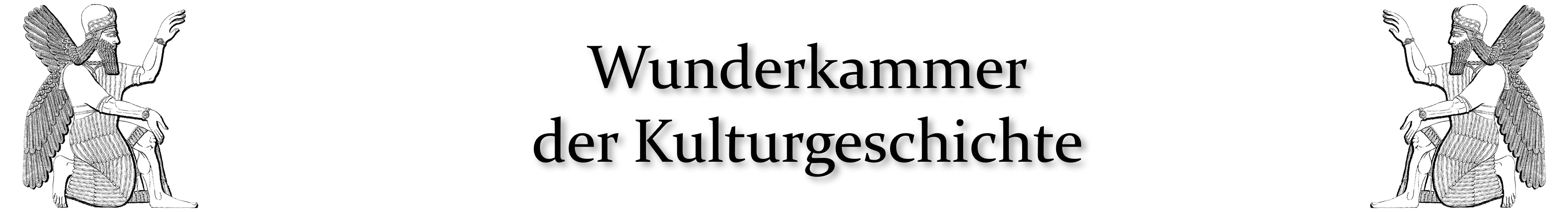Aus dem Heimatbuch des Kreises Eckernförde: Tod und Beerdigung
Mausoleum des Prinzen Heinrich, Gut Hemmelmark (Foto LI)
Bei der Beschäftigung mit alten Mythen, Sagen und Rätseln der Geschichte übersieht man allzu leicht, wie viele kuriose bis unheimliche Traditionen direkt vor unserer Haustür beheimatet sind – oder es zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts noch waren. Die Überlieferungen und Traditionen, die noch der Generation unserer Großeltern vertraut waren, sind heute vielfach ausgestorben und vergessen, sofern sie nicht von engagierten Heimatforschern schriftlich dokumentiert wurden. Ein interessantes Beispiel hierfür ist das Heimatbuch des Kreises Eckernförde von P. Willers Jessen und Christian Kock., das Beiträge zur Geographie, Lokalgeschichte, volkstümlichen Überlieferungen und Brauchtum aus der Region im östlichen Schleswig-Holstein versammelte.
Peter Willers Jessen lebte von 1870 bis 1947 in Eckernförde. Neben seinem Beruf als Lehrer und Rektor der Knabenbürgerschule (später nach ihm „Willers-Jessen-Schule“) tat er sich als Lokalpolitiker und vor allem Heimatforscher hervor. 1899 vertrat er zeitweilig den erkrankten Kustos des Museums für Vaterländische Altertümer in Kiel. Zusammen mit Christian Kock (1867–1949), ebenfalls Lehrer und Heimatforscher, gab er 1916 das Heimatbuch des Kreises Eckernförde heraus, das 1928 in einer erweiterten zweiten, 1967 und 1972 in einer zweibändigen dritten Auflage erschien.
Im Heimatbuch finden sich zahlreiche bemerkenswerte Berichte – von den archäologischen Fundplätzen und Sagen der Gegend bis hin zu historischen Hexenprozessen und Sichtungen von Walfischen in der Eckernförder Bucht. Besonders kurios und interessant zu lesen ist das Kapitel über Brauchtum und Volksglauben rund um Tod und Bestattung, das im Folgenden in voller Länge wiedergegeben sei. Wir erfahren von Todesomina, die man besser zu vermeiden hatte, von Ritualen rund um den Tod eines Menschen und sogar einem Fall von Wiedergängertum im kleinen Dorf Hemmelmark:
„[255] Von jeher ist der Tod als etwas Schreckliches und Geheimnisvolles den Menschen erschienen und fast allgemein herrscht der Glaube, daß er sich durch mancherlei Vorzeichen ankündige. Noch heute achten viele auf diese.
Schreit die Eule ums Haus, so deutet dieser Vorfall auf den nahen Tod eines Bewohners. Läßt die Totenuhr (der gemeine Klopfkäfer, Anobium pertinax L) ihr Tick, Tick in dem Gebälk der Wand hören, so ist ein Sterbefall in der Familie nahe. — Blüht eine weiße Rose im Jahre zweimal oder zeigt sich zwischen den Vergißmeinnicht ein weißes, so sind dies Anzeichen, daß bald jemand stirbt. — Fällt beim Hinabsenken des Sarges einem Leichenträger die Kopfbedeckung in das Grab, folgt der Träger bald dem Verstorbenen nach. Wirft der Maulwurf in der Nähe des Hauses oder gar in demselben auf, wird bald das Grab für einen Hausgenossen gegraben. – Träumt man von Verstorbenen, muß man bald neue Tote beklagen. — Macht der Kettenhund sich durch ungewöhnliches, anhaltendes Heulen bemerkbar, gibt es einen Sterbefall im Dorfe. Klappern nachts die Hobel in der Tischlerwerkstatt, gibt es für den Tischler einen Sarg anzufertigen. — Wird beim Säen des Korns ein Fehler gemacht, so daß eine Lücke im Kornfelde entsteht, reißt der Tod eine Lücke in die Familie. Träumt man von weißer Wäsche, gibt es einen Toten; dasselbe ist der Fall, wenn eine Henne kräht. — Die Betten darf man nicht so aufstellen, daß die Schläfer mit den Füßen nach der Tür zeigen; denn sonst wird der Schläfer bald als Toter hinausgetragen. — Tragende Stuten soll man nicht an den Leichenwagen spannen, sonst werfen sie die Füllen. Wer in den „Zwölften“, d. h. von Weihnachten bis Heilige Drei Könige (6. Januar), den Zaun mit Wäsche behängt, muß im kommenden Jahre einen Toten bekleiden. Nach Johanni (24. Juni) darf man die Wäsche nicht mehr nachts draußen liegen lassen, sonst bekommt ihr Träger Krebs und stirbt. Steht eine Leiche über Sonntag im Orte, gibt es bald einen neuen Trauerfall. [256] – Ereignet sich ein Sterbefall zwischen Weihnachten und Neujahr, gibt es im neuen Jahre viele Tote im Dorfe zu beklagen.
Ist der Tod eingetreten, so öffnet man das Fenster, damit die Seele einen Ausweg finde; auch bringt man die Wanduhr zum Stehen und verhängt den Spiegel. Der Tote darf sich nicht spiegeln, sonst zieht er bald die nach sich, die mit ihm im Spiegel sichtbar werden. Nach dem Todesfall bittet man alsbald zwei Nachbarinnen, den Verstorbenen zu waschen. Den Lappen, mit dem sie waschen, den Kamm, mit dem sie den Toten kämmen, und die ausgekämmten Haare legt man zu Füßen in den Sarg; „denn dat hört em“. Liegt der Tote mit offenen Augen da, muß man ihm diese sogleich schließen und die Augenlider durch ein aufgelegtes Geldstück bis zum Eintritt der Totenstarre in ihrer Lage festhalten. Bleiben die Augen geöffnet, so zieht der Tote bald ein anderes Familienglied sich nach. Ist der Tod durch eine ansteckende Krankheit hervorgerufen, suchen die Totenwäscherinnen sich dadurch zu schützen, daß sie einen Nelkenkopf in den Mund nehmen.
Vor 100 Jahren war es eine verbreitete Sitte, daß alte Leute sich schon bei ihren Lebzeiten einen Sarg anfertigen ließen. Ein Altenteiler, der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Loose lebte, hatte seinen Sarg (Dodenfiest) auf der „Hille“ stehen. In den Sommermonaten pflegte er im Sarge sein Mittagsschläfchen zu halten.
Der Sterbefall wurde in allen Häusern des Ortes bekanntgegeben und mit dieser Aufgabe meistens eine arme Witwe betraut, die dann mit einem Deckelkorb (Armforf) von Haus zu Haus ging und das Geschehnis verkündete. Im Korbe nahm sie milde Gaben entgegen, besonders Eßwaren, die ihr von jeder Hausfrau nach alter Sitte willig und ohne vorhergehende Bitte gewährt wurden. Sie bestellte auch die Träger. Trat der Sterbefall zur Nachtzeit ein, hielt man es für notwendig, alle Hausbewohner aufzuwecken und ihnen den Vorfall zu künden. Unterließ man es, so würden die Schläfer vom Totenschlaf befallen werden, d. h. nie von selber aufwachen. Auch allen Haustieren, sogar den Bienen, ward der Todesfall angesagt, sonst zog der Tote sie nach sich. Zu Hemmelmark hatte man dies einst unterlassen. Da sah eine Frau Stöcken am hellen Mittage die Verstorbene, wie zu ihren Lebtagen, zu ihren Bienen gehen. Die Bienen starben. Die Witwe hatte auch die Träger, in der Regel sechs, zu bestellen. Der Träger Werk war ein Ehrenamt, für das sie nichts weiter als eine reichliche Bewirtung in Speise und Trank empfingen. Handelte es sich bei dem Verstorbenen um eine ledige Person, so wählte man sechs Jünglinge zu Trägern, andernfalls sechs verheiratete Männer.
Die Verstorbenen wurden, angetan mit ihrem besten Gewand, junge Frauen nicht selten in ihrem Brautkleide, in den Sarg gelegt. Zuweilen kleidete man sie auch in ein weißes Totenhemd.
Die Beerdigung (Grabbeer, Arvbeer) fand meistens an einem Nachmittage, jedoch selten vor dem fünften Tage statt, und keiner der männlichen Dorfgenossen entzog sich ohne Grund der Beteiligung. Schon am Vormittage erschienen im Sterbehause die Verwandten und die Träger sowie der Nachbar, der den Leichenwagen fuhr. Sie alle wurden zu Mittag mit frischer Suppe bewirtet. Man glaubt, Anzeichen dafür gefunden zu haben, [257] daß dies zähe Festhalten an einer bestimmten Beerdigungsspeise seine Wurzel in einer altheidnischen Sitte hat. Nicht selten findet sich in Hünengräbern der Tote in einem Baumsarge bestattet, der mit einer Rindshaut ausgekleidet ist. Brandplätze im Umkreise des Hügels und Reste von Knochen des Rindes lassen vermuten, daß die Sippe des Toten dort ein Grabmahl hielt, bei dem die Teilnehmer das Fleisch des Rindes oder einige Teile davon verspeisten. Im Bauernhause hatte am Beerdigungstage der offene Sarg auf der „Großen Diele“ in der Nähe des Herdes Aufstellung gefunden, und zwar so, daß der Tote mit den Füßen nach der Ausgangstür gerichtet war. Auf Brust und Leib waren diesem kleine Blumenkränze gelegt, die je einen Viertelbogen Papier umgaben, darauf man einen passenden Vers geschrieben oder, wenn man selber nicht schreiben konnte, von einem Schreibkundigen hatte schreiben lassen. Etwa eine Stunde, bevor man die Leiche fortführte, erschien das übrige Trauergefolge. Jeder Kommende trat schweigend an den Sarg und betete stumm ein Vaterunser. Darauf wurden alle mit Brot und Kuchen, Braunbier, Branntwein und Met reichlich bewirtet, und zwar in alten Zeiten an Tischen und Bänken auf der „Großen Diele“ im Beisein des offenen Sarges. Dabei wurde reichlich gegessen und getrunken, von vielen überreichlich. Uns erscheint dies als Roheit. Es liegt aber ein alter, heidnischer Brauch zugrunde, der sich durch die Jahrhunderte forterbte, und man wollte den Toten, als dessen Gast man sich ansah, durch den reichlichen Genuß von Speise und Trank ehren. An das Mahl schloß sich die Parentation (dat Utsingen), eine Totenfeier, wie sie vielfach heute noch üblich ist, nur daß sie in alten Zeiten am offenen Sarge vorgenommen wurde. Im Kirchorte besorgt zumeist der Geistliche die Parentation, in den entfernteren Dörfern bat man einen Ortslehrer zu diesem nachbarlichen Dienste, der beim Gesang sich durch einige Schüler unterstützen ließ.
Danach hoben die Träger den Sarg auf den Leichenwagen, in der Regel einen Bauernwagen, wie er bei Feld- und Erntearbeiten diente. In Osterby *) war es Sitte, den Sarg mit einem großen, weißen Laken zu bedecen. Dort saßen vor dem Sarg auf einem Bügelstuhl zwei nahverwandte Frauen mit einem Rock um den Kopf. Ganz vorne auf einem Sitzbrett saß der Fuhrmann. Alle lüfteten den Hut, und die Abfahrt begann. Man hielt darauf, daß der von alters übliche Leichenweg eingeschlagen wurde, auch dann, wenn es einen näheren Weg zur Kirche gab. Der Tote möchte andernfalls keine Ruhe im Grabe finden.
Ebenso wichtig erschien unsern Vorfahren die Wahl des Begräbnisplazes. Wer es irgend ermöglichen konnte, ließ sich im Gotteshause begraben oder beisetzen. Die meisten Adelsfamilien hatten in einer oder mehreren Kirchen Erbbegräbnisse, und ihre Epitaphien zierten die inneren Kirchenwände. Andere sicherten sich durch ein Geschenk an die Kirche die Erlaubnis, ihre Verstorbenen dort begraben zu lassen, oder erwarben durch eine feststehende Abgabe sich das Recht auf „Begräbnis-Erde“ innerhalb der Kirche. So erklärt es sich, daß die alten Kirchhöfe verhältnismäßig klein waren. Nur die Armen [258] und Geringen fanden dort eine Grabstätte. In Kosel zahlte man 1764 für Begräbnis-Erde zu einer „großen Leiche“ 8 Mark, für ein Kind 4 Mark.
Die riesige Kranzfülle, die wir heute bei den meisten Beerdigungen schauen, kannte die Vergangenheit nicht. War man mit der Leiche bei der Kirchhofspforte angelangt, so hoben die Träger den Sarg vom Wagen und stellten ihn auf die mit einem Fußgestell versehene Totenbahre. Jede Kirche verwahrte in dem Turm oder in dem sogenannten Leichenhause, meistens einem seitlichen Anbau an der Kirche, gewöhnlich 2 Totenbahren, eine größere für Erwachsene und eine kleinere für Kinder. Über die Bahre wurde zunächst eine schwarze Decke gebreitet, und über den Sarg hängte man das große, schwarze „Totenlaken“. Über dieses kam der Länge nach ein weißes Tuch, „Dwehle“, das mit Stecknadeln so in Falten befestigt war, daß es genau so lang war wie der Sarg. Ebenso wurde eine Dwehle quer über den Sarg gelegt, so daß ein Kreuz gebildet wurde. Adelige Personen beschafften für die Beerdigung ihrer Angehörigen meistens einen Sargbehang aus teuren Stoffen (Samt), der nach der Beiseßung dem Prediger zufiel. Der Erlös daraus war ein Teil seiner Einkünfte. Die Träger hoben die Bahre auf ihre Schulter und schritten einmal, mancherorts auch dreimal um die Kirche und danach zum Grabe. Nur wenn eine Leichenpredigt gewünscht wurde, was jedoch nur bei den Wohlhabenden vorkam, gings unmittelbar in die Kirche. Meistens hatte es mit einer Grabrede sein Bewenden.
Solange es noch keine Totengräber gab, mußten die Dorfsgenossen, sobald die Reihenfolge an sie kam, das Grab graben, das nach der Feier von den Trägern zugeschaufelt wurde. Das Läuten bei Beerdigungen besorgten drei Hausväter nach einem feststehenden Turnus, und keiner durfte sich dieser Verpflichtung entziehen. Die Regelung dieser Angelegenheit war eine ziemlich einfache. Es ging in dem Dorfe ein Holzstab um, der nach der Beerdigung von denen, die das Läuten besorgt hatten, an die drei Nächstfolgenden weitergegeben wurde.
Nach der Beerdigung sammelten sich die Teilnehmer im Kirchspielskruge und wurden hier mit Branntwein, Braunbier und „Stuten“ bewirtet. Eine Fortsetzung des Gelages fand im Trauerhause statt, und die Sitte forderte es, daß alle, die dem Toten bis zum Grabe gefolgt waren, wiederkamen. Niemand sah etwas Anstößiges in der Schmauserei, die in der Gegenwart anderen Sitten gewichen ist. Alles geschah zur Ehre des Toten, dessen Seele man nahe wähnte, und je mehr gegessen und getrunken wurde, desto vollkommener dachte man sich die Ruhe des Verstorbenen. Viele Sterbende baten, daß für sie „en ördentliche Grabbeer“, d. h. eine reiche Bewirtung der Gäste veranstaltet werde, und hinterließen wohl gar eine oft sauer ersparte Geldsumme für diesen Zweck.“